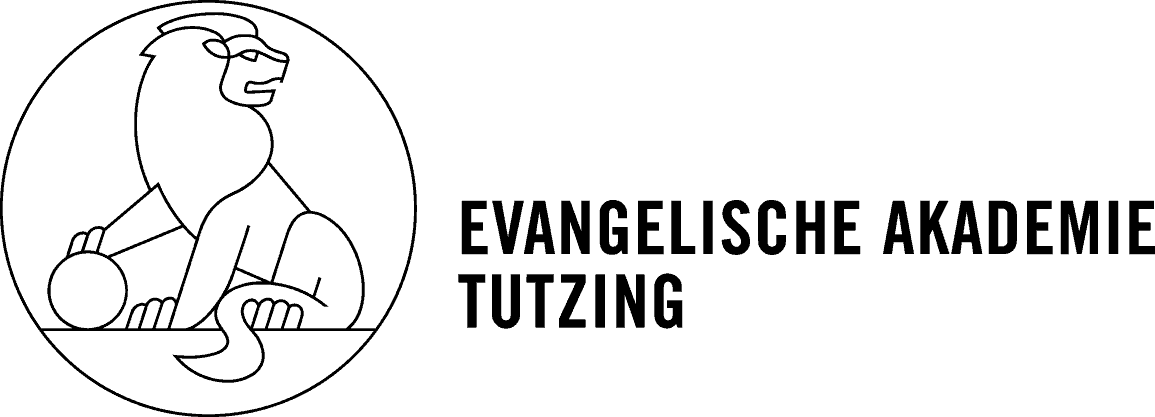Religion und Staat – Zwischen Trennung und Kooperation: Entwicklungen und Perspektiven aus kirchlicher Sicht
Vortrag von Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm zur Tagung “Religion und Staat – zwischen Kooption und Kooperation” (25 Jahre Demokratie in Südafrika) am 14. Februar 2019 an der Evangelischen Akademie Tutzing.
Es gilt das gesprochene Wort!
1. Einleitung
Die Frage, welche Rolle Religion in einer modernen pluralistischen Demokratie spielen kann, ist umstritten. Dass brutale Terroristen sich auf Religion berufen, wenn sie Angst und Schrecken verbreiten, hat bei Manchen Skepsis oder auch Ablehnung gegenüber Religion hervorgerufen oder jedenfalls verstärkt. Andere sehen freilich in diesen Phänomenen nur umso mehr den Grund dafür, die Religion aus geheimen Winkeln herauszuholen und sie gerade durch Öffentlichkeit aufklärerischer Reflexion zugänglich zu machen.
Ich möchte im Folgenden fünf verschiedene mögliche Ansätze dafür beschreiben, wie die moderne pluralistische Demokratie mit Religion umgehen kann und dann näher erläutern, warum ich das Modell öffentlicher Religion für das tragfähigste halte. Ausgehend von diesem Modell möchte ich dann erläutern, wie öffentliche Theologie Beitrag zu einem modernen demokratischen Staatswesen zu leisten vermag.
2. Religion in der pluralistischen Demokratie – Fünf Ansätze
2.1. Zivilreligiöse Begründung
Das in den USA zuerst theoretisch beschriebene Modell der Zivilreligion, auch „Religion des Bürgers“ genannt, sieht die Religion als eine entscheidende Voraussetzung, von der der demokratische Staat lebt. Hinreichend allgemeine religiöse Vorstellungen, wie sie sich etwa mit dem Wort „Gott“ verbinden, – so die Grundidee – können die Klammer sein, die ein ansonsten von Differenzen geprägtes Volk zusammenhält. Dass Staatsoberhäupter und Regierungschefs in ihren Reden explizit auf das Wort „Gott“ Bezug nehmen, ist von daher als ganz selbstverständlicher Ausdruck dieser Klammerfunktion zu sehen.
Hierzulande weckt dieses Konzept trotz seiner faktischen Wirkmächtigkeit zweifelhafte Assoziationen. Zu deutlich sind die eigenen historischen Erfahrungen mit politischer Religion in der Zeit des Dritten Reiches in Erinnerung. Aber auch heutige Erscheinungsformen von Zivilreligion, insbesondere in den USA, erzeugen bei uns eher Vorbehalte. Gerade im Hinblick auf die religiöse Konnotation der Freiheit hat es in zurückliegenden Präsidentschaftswahlkämpfen dafür reichlich Anschauungsmaterial gegeben.
Wer, so muss kritisch an diese Position zurückgefragt werden, definiert unter den Bedingungen eines religiösen und weltanschaulichen Pluralismus den religiösen Kanon, der ein Volk verbinden soll? Und warum sollen grundlegende Voraussetzungen des demokratischen Staates wie die Grundrechte notwendigerweise mit Religion verbunden werden, wenn sie auch anders begründet werden können? Eine zivilreligiöse Fundierung hat zwangsläufig Ausgrenzungscharakter gegenüber denen, die sich nicht als religiöse Menschen verstehen, aber bewusste demokratische Staatsbürger sein wollen.
Und es besteht die intrinsische Gefahr, dass eine zivilreligiöse Fundierung des Staates von den Repräsentanten dieses Staates benutzt wird, um ihr eigenes Handeln dem kritischen Diskurs soweit wie möglich zu entziehen.
2.2. „Christliches Abendland“
In diesem Antwortversuch spielt die Betonung der „christlichen Werte“ und ihre Verortung im „christlichen Abendland“ eine zentrale Rolle. Charakteristisch für diesen Begründungsansatz ist, dass er, auch da, wo er das Faktum des Pluralismus anerkennt, diesen Pluralismus auf homogene Kulturzusammenhänge gründet, deren Infragestellung als Bedrohung der Demokratie empfunden wird. Das Stichwort von der christlichen „Leitkultur“, das seit Jahren für heftige Debatten sorgt, kann als Ausdruck eines solchen Verständnisses gesehen werden. Eine solche Leitkultur wird nicht nur als gesellschaftlich zu bewahrende Kulturgrundlage gesehen, sondern gilt auch als ausdrückliche Grundlage für das Recht.
Im vergangenen Jahr haben wir gerade hier in Bayern eine intensive Diskussion darüber geführt. Anlass war der „bayerischen Kreuzerlass“. Kritik daran hat es auch aus dem Raum der Kirchen ja nicht deswegen gegeben, weil man nicht dankbar dafür wäre, dass das für uns Christen zentrale Symbol auch öffentlich sichtbar ist. Darüber kann man sich ja nur freuen. Kritik hat es v.a. aus zwei Gründen gegeben: Erstens weil das Kreuz als Symbol nicht dazu taugt, per Zwangsverordnung verbreitet zu werden. Und zweitens, weil das Kreuz eben nie als allgemein verbindliches kulturelles Symbol zur Grundlage eines pluralistisch ausgerichteten Staatswesens gemacht werden kann, ohne seinen sprezifischen religiösen Gehalt zu marginalisieren oder gar zu verlieren. Als religiöses Symbol, das ein Folteropfer darstellt, bleibt es anstößig und kann nur seine Wirkung entfalten, wenn es Zuspruch und Anspruch Gottes zugleich ausstrahlt. Ich habe deshalb gleich zu Beginn der Debatte darauf hingewiesen, dass die von mir ausdrücklich bejahte öffentliche Sichtbarkeit des Kreuzes genau die Grundlage dafür ist, dass wir der Staatsregierung immer wieder kritische Fragen stellen müssen.
Regelrecht absurd ist die Verwendung des Kreuzes und des damit verbundenen Begriffs des „Christlichen Abendlandes“ bei Demonstrationen von Pegida oder anderen Gruppierungen im rechtspopulistischen oder gar rechtsradikalen politischen Spektrum, deren markantestes Charakteristikum ihre menschliche Kälte ist. Weiter entfernt von prägenden christlichen Grundorientierungen wie Nächstenliebe, Empathie oder Eintreten für Schwachen als diese Gruppierungen kann man kaum sein.
Aber auch jenseits solcher offensichtlicher Widersprüche ist die Berufung auf das christliche Abendland kein überzeugender Ansatz – und das vor allem aus zwei Gründen:
Erstens drückt sich darin in der Regel ein problematisches Überlegenheitsbewusstsein einer als christlich bezeichneten Kultur aus, das schon durch den Blick in die Geschichte in die Schranken gewiesen wird. Michael Brenner hat im Blick auf das „christliche Europa“ einmal festgestellt: „Für uns Juden war Europa nicht das Straßburger Münster und der Spiegelsaal von Versailles, sondern die Inquisition, die Kreuzzüge, die Pogrome und die Gaskammern von Auschwitz.“
Zweitens impliziert der Begriff des christlichen Abendlandes eine kulturelle Homogenität, die es noch nie gab, die aber in jedem Falle heute in den pluralistischen Demokratien nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Der Begriff taugt nicht als programmatischer Begriff für ein Land oder einen Kontinent, der von zunehmendem religiösen und weltanschaulichem Pluralismus geprägt ist.
2.3. Multikulturelle Gesellschaft
Die Vision einer multikulturellen Gesellschaft nimmt ein friedliches Zusammenleben der unterschiedlichen Religionen in den Blick. Multikulturelle Gesellschaft heißt, dass Mehrheit und Minderheit auf der Basis der Gleichheit in gegenseitigem Respekt füreinander und mit Toleranz für die unterschiedlichen kulturell geprägten Einstellungen und Verhaltensweisen der anderen miteinander koexistieren.
Die Vision einer Gesellschaft, in der die verschiedenen Traditionen friedlich miteinander leben, kann eigentlich nur geteilt werden. Auch die Beschreibung unseres eigenen Landes und zahlreicher anderer westlicher Demokratien als Gesellschaft, in der viele Kulturen miteinander leben oder leben müssen, kann kaum in Frage gestellt werden. Rund 5 Millionen Muslime leben in Deutschland und der Islam in Deutschland ist kein homogener Block, sondern fast schon in sich so etwas wie eine multikulturelle Gesellschaft.
Die Kritik an dem Programmwort „multikulturelle Gesellschaft“ betrifft eher die Frage, ob die Konfliktdimension des Zusammenlebens der Kulturen dabei genügend deutlich wird. Wenn diese Kulturen wirklich zusammenleben, dann entstehen Konflikte zwischen den darin jeweils verbindlichen Werten. Die Familienkonflikte, die junge muslimische Frauen erfahren, wenn sie mit deutschen Männern Beziehungen eingehen und diese Beziehungen nach den hier üblichen Regeln gestalten, sind nur ein Beispiel dafür.
Die mögliche Alternative, nicht wirklich zusammen zu leben, sondern nebeneinander in jeweils homogenen Subkulturen zu leben, die häufig noch nicht einmal sprachlich miteinander kommunizieren können, ist jedenfalls keine Lösung.
Für ein Zusammenleben, das die Identität des jeweils anderen wirklich ernst nimmt und Regeln ins Auge fasst, die für alle verbindlich sind und bei der Konfliktregelung helfen können, reicht das Stichwort „multikulturelle Gesellschaft“ trotz seiner Plausibilitätsanteile nicht aus.
2.4. Privatisierung der Religion
Die Privatisierung der Religion, das Verdrängen der Religion aus der Öffentlichkeit ist das Ziel von laizistischen Modellen, die ihre Basis in einem Diskurs der Vernunft sehen. Prototyp dieses Modells ist die französische „Laicité“. Vieles ist gegen dieses Modell einzuwenden: Religionsfreiheit – so muss klargestellt werden – gewährleistet nicht das Recht, von der Religionsausübung anderer unberührt zu bleiben. Richtig ist, dass Religion eine höchstpersönliche Sache ist, nicht aber eine „Privatsache“ in dem Sinne, dass man sie in das „stille Kämmerlein“ verbannen dürfte. Es gibt schlicht und einfach überhaupt keinen vernünftigen Grund für den Staat, philosophisch begründete Weltanschauungen gegenüber religiösen Weltanschauungen zu bevorzugen. Der Staat, will er wirklich weltanschaulich neutral sein, muss beidem im öffentlichen ebenso wie im privaten Leben Raum geben.
Dazu kommt ein Argument, das die Wirkungen auf die gesellschaftliche Kultur betrifft: die Privatisierung von Religion fördert nicht Toleranz und Offenheit für die Vielzahl verschiedener Konzeptionen des Guten in einer Gesellschaft, sondern sie hemmt sie oder verhindert sie möglicherweise sogar. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit Religion fördert den reflektierten Umgang damit. Laizistische Modelle bieten deswegen keine Lösung für die Frage nach einem angemessenen Verhältnis von Religion und pluraler Demokratie.
In dieser Hinsicht ist vom Modell der „Öffentlichen Religion“ mehr zu erwarten. Ich will deswegen näher darauf eingehen.
2.5. „Öffentliche Religion“
Die Grundlage dieses Konzeptes ist für mich die Idee eines übergreifenden Konsenses in einer demokratischen Gesellschaft, wie sie v.a. von John Rawls formuliert worden ist.[1] In einer solchen Gesellschaft – so der Grundgedanke – kann von einer großen Vielfalt verschiedener Konzeptionen des guten Lebens ausgegangen werden. Die Vertreterinnen der jeweiligen Konzeptionen bringen ihre Ideen und Werte in die gesellschaftliche Gemeinschaft ein, indem sie öffentlich dafür eintreten.[2] Keine dieser allgemeinen und umfassenden Konzeptionen des Guten kann sich selbst zur einzig legitimen erklären und gesetzlich verbindlich machen. Alle Konzeptionen teilen aber ein Minimum an fundamentalen Werten. Diese Werte sind in unterschiedlicher Weise in den religiösen, moralischen oder philosophischen Traditionen der jeweiligen Konzeptionen des Guten gegründet. Alle überschneiden sie sich aber im Hinblick auf bestimmte Grundannahmen über die Bedeutung des Menschseins, auch wenn die Interpretationen dieser Grundannahmen sich unterscheiden mögen.
In den Menschenrechten kommt die Grundannahme der unverletzlichen Würde der menschlichen Person zum Ausdruck, über die sich die meisten Menschen verständigen können.
Der öffentlichen Kommunikation kommt für die Regenerierung dieses Grundkonsenses zentrale Bedeutung zu. Die verschiedenen speziellen Konzeptionen des Guten dürfen nicht ausschließlich in den Raum der jeweiligen Binnengemeinschaft verbannt werden, sie müssen vielmehr als Quelle leidenschaftlicher Beiträge zur öffentlichen Kommunikation gedacht werden. Die Aufrechterhaltung und lebendige Weiterentwicklung eines übergreifenden Konsenses bedarf des öffentlichen Engagements der verschiedenen religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften, die eine pluralistische Gesellschaft prägen.
Die grundlegenden Orientierungen, die in einer demokratischen Gesellschaft gelten, die also ihren übergreifenden Konsens ausmachen, können ja nicht allein oder vorrangig durch den Staat kontinuierlich erneuert werden, sondern sie leben daraus, dass die unterschiedlichen Traditionsgemeinschaften, in denen die Menschen in diesem Staat leben, sie von ihren jeweiligen Traditionen her mit Leben füllen. Diese Traditionen sind es, die sicherstellen, dass die Werte und Grundorientierungen in Staat und Gesellschaft, wie sie in den Menschenrechtskatalogen ihren rechtlichen Ausdruck gefunden haben – immer wieder neue Nahrung bekommen. Früher wurden solche Traditionen hierzulande fast ausschließlich von den Kirchen, aber auch den jüdischen Gemeinden, weitergetragen. Heute – unter den Bedingungen des Pluralismus – werden sie auch von religionskritisch-aufklärerischen Gemeinschaften wie dem Humanistischen Verband oder anderen Religionsgemeinschaften wie den islamischen Gemeinden gepflegt.
Es ist genau die Begründungsoffenheit der Grundorientierungen, von denen unser Staat lebt, die ihre Regeneration auch unter den Bedingungen einer pluralistischen Gesellschaft ermöglicht.
Weil der Staat in seiner Grundsubstanz von der Vitalität von Traditionen lebt, die seinen humanen Charakter über rechtliche Regelungen hinaus mit Leben füllen, deswegen ist es so weise, wenn er die öffentliche Rolle der religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich bejaht, wie das in unserem Grundgesetz der Fall ist. Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und öffentlich finanzierte Lehrstühle für christliche, jüdische und islamische Theologie sind genau die richtige Antwort auf die Frage, woraus die Werte einer Gesellschaft sich erneuern können. Dass fundamentalistische Formen von Tradition keine öffentliche Finanzierung verdienen, versteht sich von selbst, denn sie stärken nicht den übergreifenden Konsens, sondern sie sabotieren ihn.
3. Wie können sich Religionen in den öffentlichen Diskurs einbringen?
Religiöse Beiträge dürfen nicht allein der konfessorischen Selbstbestärkung dienen und +sich damit hermetisch abschließen gegen vernünftige Argumentation. Sie müssen vielmehr offen und anschlussfähig sein für vernünftige Argumentation und Erläuterung. Auch nicht-religiösen Menschen muss deutlich gemacht werden können, warum die darin vertretenen inhaltlichen Punkte Sinn machen.
In der Theologischen Ethik – so kann einigermaßen zuverlässig festgestellt werden – besteht im Hinblick auf diese Voraussetzung für einen produktiven Beitrag der Theologie zum öffentlichen Diskurs ein breiter Konsens. Die verschiedenen Beiträge zu der internationalen Diskussion um eine „öffentliche Theologie“ etwa verbindet genau das Anliegen, Einsichten biblisch geprägter theologischer Ethik in den öffentlichen Diskurs einzubringen und dabei ihre Plausibilität und Einsehbarkeit für alle Menschen guten Willens deutlich zu machen.[3] Ich spreche dabei von der „Zweisprachigkeit“, zu der die Theologie in der Lage sein muss: Zum einen muss sie ein klares theologisches Profil aufweisen und auch zum Ausdruck bringen. Zum anderen muss sie in der Lage sein, in der Sprache öffentlicher Vernunft plausibel zu machen, warum ihre theologischen Impulse wichtige Orientierung für die Gesellschaft als ganze zu geben vermögen.
3.1. Sehen: Die aufklärerische Dimension
Bei der aufklärerischen Dimension geht es um die Offenlegung der ethischen Tiefendimensionen des öffentlichen Diskurses. Grundlegende Orientierungsfragen, verstecken sich hinter konkreten politischen Entscheidungssituationen – die die Öffentlichkeit beschäftigen. Es gibt einen gesellschaftlichen Orientierungsbedarf in Grundfragen des Menschseins mit öffentlicher und politischer Relevanz. Das wird anhand von zahlreichen Debatten um solche Themen deutlich, die in Zeitungen und Talkshows geführt werden. Bioethische Fragen gehören genauso dazu wie die Debatte um soziale Gerechtigkeit oder die Frage nach der Legitimität militärischer Gewalt.
Die Kirche ist heute Teil einer pluralistischen Gesellschaft mit vielen Orientierungsangeboten. Wenn die Frage gestellt wird, an welchen Orten eigentlich über grundsätzliche Orientierungen nachgedacht wird, wenn nach den Quellen sozialen Zusammenhalts gefragt wird, dann spielen die Kirchen aber nach wie vor eine zentrale Rolle.
Da die Theologie im interdisziplinären Diskurs der Wissenschaft vielleicht mehr als jede andere Disziplin gezwungen ist, ihre je eigenen normativen Voraussetzungen kritisch zu reflektieren, bringt sie das notwendige Rüstzeug mit, genau das auch in der Gesellschaft insgesamt einzufordern. Die normativen Tiefendimensionen von gesellschaftlichen Debatten freizulegen, ist die erste Voraussetzung dafür die Debatten so substanziell zu führen wie sie es verdienen.
Was ist die Bezugsgröße für wirtschaftlichen Erfolg? Noch immer legen wir in unseren öffentlichen Debatten viel zu oft das Bruttosozialprodukt dabei zugrunde. Wenn die Nachrichtensendungen eine Steigerung der allgemeinen Wirtschaftsleistung vermelden, gilt das als Erfolg. Dabei kann darüber nur dann substantiell geurteilt werden, wenn auch die Kosten für die außermenschliche Natur und die Auswirkungen der Steigerung der allgemeinen Wirtschaftsleistung auf die Situation der Schwächsten mit in den Blick kommen. Misst eine Gesellschaft ihren Erfolg am Schicksal ihrer schwächsten Glieder oder am Durchschnittsnutzen? Je nachdem, welches der beiden Kriterien den Ausschlag geben, können die Ergebnisse völlig unterschiedlich sein. Diese Tiefenschärfe bei den Debatten überhaupt zu gewinnen, ist eine aufklärerische Leistung. Die Theologie kann dabei einen wichtigen Beitrag leisten.
3.2 . Urteilen: Orientierende Dimension
Eine Gesellschaft lebt von Narrativen. Der biblische Narrativ der Befreiung aus Unterdrückung verdient dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Weil Gott uns als sein Volk aus der Sklaverei errettet hat, deswegen sollen wir selbst auch für die Schwachen einstehen.
Schon das Urbekenntnis Israels stellt den Gott ins Zentrum, der sein Volk aus der Unterdrückung in Ägypten geführt hat. Deswegen werden auch die Gesetze, die die Schwachen schützen, seien es die Witwen, die Waisen, die Verschuldeten oder die Fremden, immer wieder mit der Erinnerung an dieses Eintreten Gottes für sein unterdrücktes Volk eingeleitet: „…denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland“. Die alttestamentlichen Propheten prangern genau deswegen die sozialen Ungerechtigkeiten ihrer Zeit so scharf an, weil sie den Vorrang für die Schwachen einer Mentalität zum Opfer fallen sehen, die trotz Überfluss nach immer mehr Besitz strebt und die Armen vergisst. Gegenüber allen Verlustängsten der Wohlhabenden angesichts der Forderung nach Gerechtigkeit betont der Prophet Jeremia: „Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt dennoch auf Recht und Gerechtigkeit, und es ging ihm gut? Er half dem Elenden und Armen zum Recht, und es ging ihm gut. Heißt dies nicht, mich recht zu erkennen? spricht der Herr“ (Jer 22,15-16). Gerechtigkeit – das wird hier vorausgesetzt – ist untrennbar verknüpft mit Gotteserkenntnis.
Jesu Wort und Tat – wie die Evangelien sie darstellen – steht ganz in dieser Tradition. Er selbst sieht sein Wirken als Erfüllung der alten Verheißung, dass „den Armen das Evangelium gepredigt“ werde (Lukas 4,18-21). Seine besondere Zuwendung gilt den Armen und Ausgestoßenen. Das Handeln an den Schwachen, also den Hungrigen, den Durstigen, den Kranken, den Nackten, den Fremden oder den Gefangenen wird mit dem Handeln gegenüber Christus selbst gleichgesetzt: „Was ihr den geringsten meiner Brüder getan hat das habt Ihr mir getan“ (Mt 25,40).
In diesen biblischen Narrativen stecken klare Grundorientierungen auch für heutige Debatten einer global vernetzten Wirtschaft. Die darin zum Ausdruck kommende Orientierung an der Menschenwürde ist eine klare Sperre gegen reine Profitorientierung. Wenn der Mensch, wie es die berühmte Kantsche Definition der Menschenwürde zum Ausdruck bringt, wirklich Zweck an sich ist und nie auf ein Mittel zum Zweck reduziert werden darf, dann hat das sehr konkrete Konsequenzen. In der Unternehmerdenkschrift der EKD wird das deutlich gemacht am Beispiel der Beschäftigten eines Betriebes:
„Wenn die Mitarbeiter … in ihren grundlegenden menschlichen Bedürfnissen missachtet und damit in ihrer Würde ignoriert werden, werden sie darauf reduziert, Mittel zum Zweck zu sein… Eine solche Reduzierung von Beschäftigten auf das Mittel zum Zweck drückt sich aus, wenn Entlassungen nicht nur als allerletzte Möglichkeit eingesetzt, sondern allein zur Erhöhung von ohnehin hohen Gewinnen vorgenommen werden. Sie drückt sich aus, wenn Unternehmen Mitarbeitende in Schwellenländern zu Hungerlöhnen beschäftigen und sie unter Bedingungen arbeiten lassen, die Leben und Gesundheit gefährden, oder wenn Kinder ohne Schulabschluss arbeiten müssen. Sie drückt sich aus, wenn Beschäftigte sich hierzulande nicht mehr trauen, im Krankheitsfall zu Hause zu bleiben oder zum Arzt zu gehen, oder auch, wenn im Unternehmen ein Klima herrscht, in dem alle menschliche Kommunikation allein dem wirtschaftlichen Unternehmenszweck untergeordnet wird und das soziale Gefüge keine Rolle mehr spielt.“ (33).
3.3. Handeln: Politik ermöglichende Dimension
Dem Sehen und dem Urteilen muss auch ein Handeln folgen. Deswegen hat öffentliche Theologie auch eine politikermöglichende Dimension. Das ist deswegen nicht nur eine praktische, sondern auch eine theologische Frage, weil die Frage, ob Theologie praxistauglich ist, auch eine Frage theologischer Qualität ist. Eine Theologie, die die philosophische Abstraktion zum Selbstzweck macht oder auch eine Theologie, die sich im prophetischen Gestus gefällt, ohne damit irgendetwas zu verändern, ist keine gute Theologie. Und eine Sozialethik, die nur dann funktioniert, wenn man sie nie anwenden muss, ist eine schlechte Sozialethik!
Deswegen gehört zu einer substantiellen öffentlichen Theologie immer auch das Gespräch mit der Politik. Die Theologie muss und kann nicht immer Lösungen für die Probleme haben, die sie kritisch in den Blick nimmt und in die öffentlichen Debatten einbringt. Aber sie muss bei ihren kritischen Fragen diejenigen solidarisch im Blick haben, die tatsächlich politische Verantwortung tragen und bei vielen Fragen mit faktischen Dilemmasituationen konfrontiert sind, die schwer aufzulösen sind. Deswegen ist der Ort, von dem her die Kirche als die Institution, die die Impulse der Theologie aufnimmt, ihre Beiträge zur gesellschaftlichen Debatte einbringt, nicht der moralische Hochpodest, sondern der runde Tisch, an dem sie durch die Kraft ihrer Inspiration und die Qualität ihrer Argumente andere überzeugen kann.
Die Formen, die die Kirchen dafür wählen, sind vielfältig. Evangelische Denkschriften oder päpstliche Enzykliken zählen ebenso dazu wie Ökumenische Stellungnahmen, öffentliche Äußerungen kirchenleitender Personen, Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, Gespräche mit Parteien und Organisationen oder auch diskrete Interventionen in der Politik, wie etwa beim Kirchenasyl. Eine besondere Bedeutung hat dabei das das internationale Netzwerk der Kirchen, das – etwa bei der Klimapolitik – die Stimme der globalen Weltgemeinschaft in die nationalen Debatten einbringt.
4. Schluss
Vielleicht ist gerade jetzt eine Religion, die für Freiheit, Toleranz und Einsatz für die Schwachen ei tritt, von besonderer Bedeutung auch für den Staat. Die Herausforderungen unserer Zeit sind groß. Vielleicht ist die größte Herausforderung unserer Zeit, angesichts von so viel Ungerechtigkeit, Hass, Gewalt, Intoleranz und all dem damit verbundenen Leid nicht die Hoffnung zu verlieren. Für unser Land ist es deshalb von entscheidender Bedeutung, ob wir Quellen solcher Zuversicht haben. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage: Ja, wir haben solche Quellen der Zuversicht. Wir müssen sie nur wieder neu entdecken. Mit der auf dem Judentum gegründeten christlichen Botschaft haben wir die kraftvollste Hoffnungsgeschichte, die die Welt je gesehen und gehört hat. Es ist die Geschichte von einem Volk, das aus der Sklaverei herausgeführt wird ins gelobte Land. Es ist die Geschichte von dem Volk, das in der Gefangenschaft des babylonischen Exils zu verzweifeln droht und dann die wunderbare Erfahrung der Rettung macht. Es ist die Geschichte von dem Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er selbst Mensch wird, dass er am Kreuz die tiefste Dunkelheit mit den Menschen teilt und in der Auferstehung den Tod überwindet. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Gewalt hat nicht das letzte Wort. Das Leben siegt.
Wir brauchen eine Reformation der Hoffnung und der Zuversicht in unserem Land und in der ganzen Welt. Wir brauchen Menschen, die sich für die Schwachen einsetzen, Menschen, die Gewalt überwinden und die die außermenschliche Natur achten. Menschen, die radikal lieben, weil sie Kraft schöpfen aus dem Gott, der selbst die radikale Liebe ist.
Menschen, die ernstnehmen, was Dietrich Bonhoeffer einmal so gesagt hat:
„Wenn schon die Illusionen bei den Menschen eine so große Macht haben, dass sie das Leben in Gang halten können – wie groß ist dann erst die Macht, die eine begründete Hoffnung hat? Deshalb ist es keine Schande, zu hoffen, grenzenlos zu hoffen!“
Davon können wir nie genug kriegen!
[1] Siehe insbesondere John Rawls, Der Gedanke eines übergreifenden Konsenses, in ders., Die Idee des politischen Liberalismus, Aufsätze 1978-1989, Frankfurt/Main 1992, 293-332.
[2] Eine der gängigsten kritischen Anfragen an Rawls’ Gerechtigkeitstheorie geht von der Annahme aus, dass sein Gedanke des Vorrangs des Rechten vor dem Guten eine Privatisierung des Guten bedeute (vgl. dazu F. Schüssler Fiorenza, 1989, 131). Ich halte diese Kritik nicht für gerechtfertigt. Der Vorrang des Rechten vor dem Guten heißt nur, dass starke Konzeptionen des Guten nicht durch staatliche Machtmittel zwangssanktioniert werden dürfen. Nirgendwo bei Rawls lassen sich Anzeichen dafür finden, dass starke Konzeptionen des Guten auf den Bereich des Privaten verbannt bleiben sollen, anstatt in den öffentlichen Diskurs eingebracht zu werden.
[3] Zum Konzept der „öffentlichen Theologie“ vgl. näher H. Bedford-Strohm, Position beziehen. Perspektiven einer öffentlichen Theologie, München 2012. Die gegenwärtige beste Darlegung des Paradigmas der öffentlichen Theologie findet sich bei F. Höhne Öffentliche Theologie. Begriffsgeschichte und Grundagen, Leipzig 2015. Wichtige Grundtexte sind enthalten in F. Höhne/F. van Oorschot (Hgg.), Grundtexte Öffentliche Theologie, Leipzig 2015. Zur allgemeine Diskussion vgl. W. Vögele, Menschenwürde zwischen Recht und Theologie. Begründungen von Menschenrechten in der Perspektive öffentlicher Theologie, Gütersloh 2000, 23-28. Vgl. die Definition des Begriffs bei W. Huber: „Als `öffentliche Theologie` bezeichne ich das theologische Vorhaben, die Fragen des gemeinsamen Lebens und seiner institutionellen Ausgestaltung in ihrer theologischen Relevanz zu interpretieren und den Beitrag des christlichen Glaubens zur verantwortlichen Gestaltung unserer Lebenswelt zu ermitteln“ (W. Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Gütersloh 1996, 14). Für die amerikanische Diskussion vgl. R. Thiemann, Constructing a Public Theology. The Church in a Pluralistic Culture, Louisville 1991; ders. Religion in Public Life. A Dilemma for Democracy, Washington D.C 1996; sowie M. Stackhouse, General Introduction, in: M. Stackhouse/P. Paris, Religion and the Powers of the Common Life (God and Globalization Vol. 1), Harrisburg 2000, 1-52.