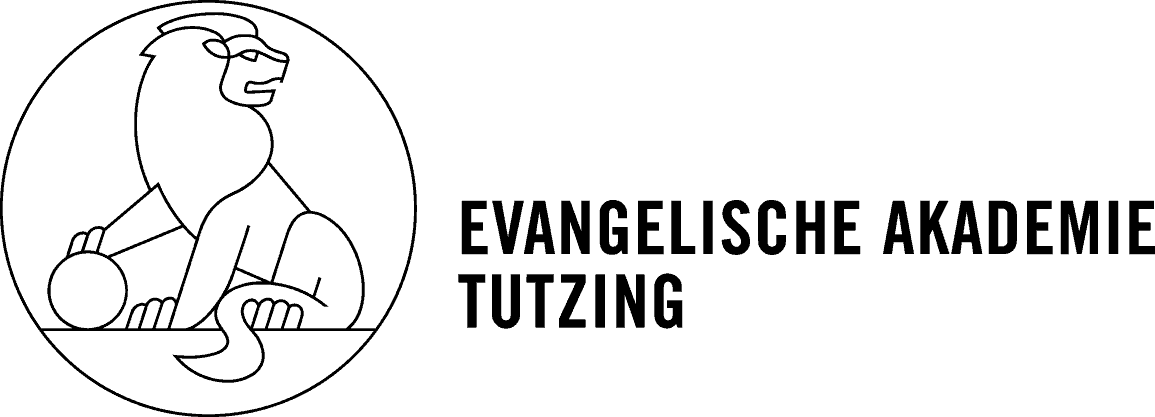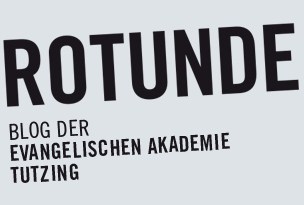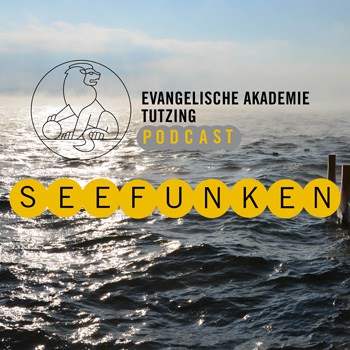“Die Suche nach neuen Wegen”
Es sind spannende Zeiten, in denen wir leben. Das betrifft auch die Kultur. In der Sommertagung des Politischen Clubs ging es unter dem Titel “Kulturpolitik, Kulturjournalismus, Kulturkampf” sowohl um die gegenwärtige Gleichzeitigkeit von Erfolg und Niedergang der Kunst- und Kulturbranche, den Kulturbegriff an sich als auch um die Herausforderungen, vor denen Kulturschaffende, Institutionen, Journalismus und Politik aktuell stehen. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht.
→ Zur Bildergalerie gelangen Sie hier
Das Programm der Tagung können Sie hier abrufen.
“Kultur ist der Spielraum der Freiheit”. Mit diesem Zitat des evangelischen Theologen und Widerstandkämpfers Dietrich Bonhoeffer aus dem Jahre 1941 eröffnete Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, die Sommertagung 2025 des Politischen Clubs zum Thema “Kulturpolitik, Kulturjournalismus, Kulturkampf”. Kunst benötige Ressourcen sowie innere und äußere Freiheit, um stattfinden und sich entwickeln zu können. Gleichzeitig beobachtet Hahn eine zunehmende Infragestellung der Freiheit der Kultur. In Zeiten, in denen die Kulturlandschaft unter Druck stehe, stellte er klar: Die Förderung von Kultur und die Sicherung ihrer Vielfalt seien politisch unerlässlich und stellten auch zentrale Aufgaben der Tagungsarbeit dar.
Roger de Weck, Publizist und Leiter des Politischen Clubs, knüpfte in seinen Einführungsworten an Udo Hahn an und betrachtete zunächst die drei Schlagwörter Kulturpolitik, Kulturjournalismus und Kulturkampf und stellte aktuelle Fragen und Aufgaben in den Fokus.
Zu Beginn definierte de Weck zwei zentrale Säulen der Kulturpolitik: die Förderung und die Rahmenbedingungen von Kultur. Beide seien mit Herausforderungen konfrontiert. Im Bereich der Förderung stellten sich Fragen der Zuständigkeiten und der Verteilung: Wer fördert wen, mit wie viel und warum? Dahinter stünden grundlegende Fragen: Was verstehen wir unter Kultur – was gehört dazu, was nicht? Welcher Kulturbegriff wird in der Kulturpolitik überhaupt verwendet und wer bestimmt ihn? Die Rahmenbedingungen von Kultur seien aktuell von Debatten um Kunstfreiheit, digitale Weiterentwicklung, globale Krisen und politische Ausrichtungen geprägt. Roger de Weck resümierte: “Kulturpolitik ist die Kunst des Möglichen, des Unmöglichen und auch des Dazwischen.”
Journalismus sei ein ebenso zentraler Akteur der Kulturlandschaft, der noch dazu im engen Zusammenhang mit Kulturpolitik stehe, führte de Weck fort. Denn “Kulturpolitik ist Medienpolitik”. Er erinnert daran, dass Journalistinnen und Journalisten durch Rezensionen und feuilletonistische Beträge Debatten über Kultur mit leiten, kulturelle Berichterstattung und mediale Darbietungen aber auch immer wieder selbst zum Gegenstand von Diskussionen werden. Roger de Weck betonte darüber hinaus die besondere Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien, ohne die “Kulturpolitik fast nicht mehr zu denken” sei.
Der Leiter des Politischen Clubs beklagte darüber hinaus einen zunehmenden Kulturkampf: “Vieles wird skandalisiert, was früher als ganz normal galt.” Roger de Weck beschrieb dieses Phänomen wie folgt: “Sie stempeln den Widersacher zum Feind, weil sie die eigene Weltsicht, die eigene Sprache nur gelten lassen.” Ein Phänomen, dass in den Augen von de Weck nicht nur das gesellschaftliche Miteinander herausfordere, sondern auch das politische Wirken. “Es erschwert Kulturpolitik, wenn sie Kulturkampfpolitik sein soll.”
Björn Wilhelm: “Welchen Platz hat die Kultur in der digitalen Welt?”
“Kultur ist konstitutiv, Fundament für unsere mündige Gesellschaft. Sie muss ihren Platz, auch in der digitalen Welt haben, das ist wichtig und ja, dafür müssen wir etwas tun.” So eröffnete Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks, das Tagungswochenende. In seinem Impuls zur Frage nach dem Platz der Kultur in der digitalen Medienwelt beschrieb er zunächst ein “Zeitalter der Widersprüche”. Auf der einen Seite erlebten wir eine “Hochzeit der Kreativität”. Noch nie sei so viel produziert und konsumiert worden. Das Angebot und die Verfügbarkeit von Kultur und Medien sei für Konsumentinnen und Konsumenten nie größer, das Erreichen von Zielgruppen für Kunstschaffende nie leichter gewesen. Nach Wilhelm entstehe auf diese Weise “maximale Freiheit”. Gleichzeitig beobachte er auf Seiten der Medienproduktionen einen wachsenden Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit und finanzielle Herausforderungen. Wilhelm attestierte schwerwiegende Folgen für Individuum und Gesellschaft: Der Trend der Hyperindividualisierung führe weg von Verständigung und hin zu Orientierungslosigkeit, Einsamkeit und fehlenden gemeinschaftlichen Erfahrungen. Er fragte: “Wo sind die Lagerfeuermomente dieser Gesellschaft?”
Wilhelm sieht in den Entwicklungen “weder Utopie noch Dystopie, sondern einfach unsere Aufgabe. Wie begegnen wir dem als Gesellschaft und als Kulturschaffende?” Er entwickelte aus seiner Perspektive als BR-Kulturprogrammdirektor vier Thesen bzw. Handlungsaufforderungen. Erstens plädierte Wilhelm für mehr Vorausdenken in Kultur und Medien. Es brauche kreative Ideen, um junge Generationen auf ihren Wegen und Plattformen zu erreichen und sie dort für Kultur zu begeistern. Zum zweiten sprach er sich für “geschickte Programmierung als Prinzip” aus. Sein Ziel sei es, Kulturprogramm im Anschluss quotenstarker Sendungen zu platzieren, um auf diesem Wege möglichst viele Menschen zu erreichen. Es sei notwendig, kulturelle Sendungen “aus der Nische” zu holen und sie so zu präsentieren, dass nicht das Gefühl “Achtung, Kultur!” entstehe. Als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei es seine Aufgabe und Verständnis, Kultur als ein “Jedermann-Programm” anzubieten.
In diesem Zusammenhang plädierte Wilhelm für ein breites Kulturverständnis, gegen ein Gegeneinander und für ein Zusammenstehen von Kulturangeboten unterschiedlicher Formate, unterschiedlicher Art und Tradition. Als dritten Auftrag der Kultur- und Medienbranche formulierte er den Ausbau der Breitenwirkung durch eine Intensivierung des Kontaktes zu Nutzerinnen und Nutzern. Wörtlich sagte er: “Austausch mit der Community ist ein Gebot der Stunde und was passt besser zu Kultur? Auch sie entsteht im Dialog.” Viertens wies Björn Wilhelm auf das notwendige Vertrauen in Kultur und in Medien hin. Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch in Zukunft Menschen wert auf kulturelle Angebote legen.
Dr. Konrad Schmidt-Werthern: “Kulturpolitik”
“Ici, on pense lentement” (“Hier denkt man langsam”) – ein Motto, das Dr. Konrad Schmidt-Werthern, den Leitenden Beamten beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, schon lange begleite und das er hier in Tutzing wiederfand. Zu Beginn seines Impulses lobte er die Evangelische Akademie Tutzing als einen Ort des langsamen Denkens, als einen Ort für Zeit, Zweifel und Diskussion, der in krisenhaften Zeiten besonders nötig sei.
Mit krisenhaften Zeiten sieht Schmidt-Werthern auch die Kultur in Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus konfrontiert. Das sei mit Blick auf die Vergangenheit nicht ungewöhnlich, denn “jede Krise hatte immer auch etwas mit Kultur zu tun und ihrer Bedeutung”. Bedeutungsvoll sei Kultur ebenfalls für das demokratische Zusammenleben, so Schmidt-Werthern. “Kunst und Demokratie bedingen einander, sie brauchen den offenen Raum der Freiheit. Und so misst Kultur nicht nur die Temperatur der Freiheit, sondern sie gestaltet auch diese.”
Schmidt-Werthern ging in seinem Impuls auch auf die Kulturpolitik der neuen Bundesregierung ein. Damit Kultur und Medien in Deutschland weiterhin sicher stattfinden und so ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen können, habe der neue Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Wolfram Weimer, zusammen mit seinem Ministerium in der jungen Amtszeit bereits einige Schwerpunkte für den Schutz und die Förderung der Kulturlandschaft in Deutschland formuliert. Diese umfassten: den Schutz von Jüdinnen und Juden und die Weiterführung des Projekts zur Rückgabe jüdischer Kunst, die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit in Bezug auf Medienstruktur, Rechtslage und Versteuerung von Medienprodukten, Ideen innovativer Kulturvermittlung an jüngere Generationen, die Sicherung finanzieller Förderung, die Stärkung der finanziellen Gestaltungsfreiheiten von Kulturinstitutionen und die Stärkung des Urheberrechts. Bei allen Vorhaben betonte Konrad Schmidt-Werthern: “Mein Platz und der Platz des BKM ist bei den Kreativen und nicht beim Wirtschaftsministerium.”
Dr. Kia Vahland: “Kultur und Demokratie: Vom Wert des Imaginären”
Dr. Kia Vahland, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung mit den Schwerpunkten Kunst, Kultur, Geschichte und Politik, griff in ihrem Impuls die Parallelität von Kulturgewinn und Gefährdung auf. “Die Gleichzeitigkeit, die wir gerade erleben, von Erfolg und Niedergang ist erstaunlich.” Angesichts der Anzahl kulturschaffender und interessierter Menschen, des boomenden Buchhandels und der Verkaufszahlen von Eintrittskarten für Museen, Konzerten und Theatern stellte Vahland fest: “Kulturpessimismus ist – zumindest in Deutschland – fehl am Platz.” Kultur werde politisch jedoch nicht zur systemrelevanten Infrastruktur gezählt und sei deswegen besonders von Sparmaßnahmen betroffen. Kia Vahland warnte vor dieser Entwicklung: “Es sind ja nur die demokratischen Parteien, die gerade Sparmaßnamen ansetzen und die Kultur für verzichtbar bezeichnen. Extremistische Parteien tun das nicht, sie setzen auf die Kultur.” Dies geschehe zum einen mit Angriffen auf die Freiheit von Kunstschaffenden durch Debatten um “einseitige Darstellungen” und Mittelkürzungen. Zum anderen wüssten rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker von der Wirkmacht menschlicher Fantasie und nutzten Erzählungen und Inszenierungen für die Verbreitung von Geschichten, Ideologien und Feindbildern.
Für den Schutz des demokratischen und vielfältigen Zusammenlebens brauche es gerade deswegen unbedingt Kulturangebote, die Kunsträume anbieten und Denkräume gestalten. “Kultur verschließt und verarbeitet das Imaginäre, sie konfrontiert uns mit den Gedanken anderer Personen, die uns vielleicht überraschen.” Kunst und Kultur nähmen damit eine zentrale Aufgabe wahr. Sie böten den Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, sich mit eigenen Bildern auseinanderzusetzen, mit Wahrnehmungen anderer konfrontiert zu werden und über Unterschiede in den Dialog zu kommen. “Sie schützt uns davor, unsere Gedanken als die einzig wahre Realität zu betrachten.”
Patrick Bahners: “Geschichtskultur und Anti-Antisemitismus”
Patrick Bahners, Redakteur im Feuilleton und verantwortlich für das Ressort Geisteswissenschaften der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), legte den Fokus in seinem Impuls auf Kulturkämpfe. “Es gibt Topoi, es gibt rhetorische Strategien und es gibt auch sachliche Punkte, bei denen es einen Widerstreit gibt”, sagte er. Dabei stünden “Freiheit auf der einen, Institutionen auf der anderen Seite”. Er plädierte dafür, von schnellen Schlüssen Abstand zunehmen. Stattdessen gelte es, erhitzte Debatten und ihren Gegenstand mit Ruhe, Sorgfalt und Differenzierung zu betrachten.
Seine Perspektive erklärte Bahners anhand eines Beispiels. Dazu griff er einen Skandal um Rainer Werner Fassbinder von 1976 auf, den die Veröffentlichung seines Theaterstücks “Der Müll, die Stadt und der Tod” beim Suhrkamp Verlag auslöste. Joachim Fest, damals Mitherausgeber und Feuilletonchef der FAZ, kritisierte Fassbinder für die vorurteilsbehaftete Art, mit der Fassbinder eine jüdische Figur des Dramas gezeichnet hatte. Fest warf Fassbinder vor, Teil eines “systematischen neuen Antisemitismus von links” zu sein, der eines neuen kapitalistischen Gegenbildes bedarf. Verteidigungen Fassbinders zum Trotz entwickelte sich der Skandal: Aufführungen des Theaterstücks wurden von jüdischen Schauspielenden mit politischer Unterstützung verhindert, der Verlag zog das Buch zurück und die “Diskussion entfernte sich gelegentlich von dem eigenen Gegenstand”, so Bahners. Fassbinder verteidigte sich. Sein Ziel sei es gewesen, jüdisches Leben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die Mitarbeit von Jüdinnen und Juden im Wiederaufbau der Bundesrepublik darzustellen. Sein Mittel war das Enttabuisieren von Tabus. Fassbinder hatte demnach genauso die Bekämpfung von Antisemitismus zum Ziel wie Fest in seiner Anklage.
Patrick Bahners warnte schlussfolgernd vor vorschnellen Zensuren und einseitig geführten Debatten. “Wenn eine Diskussion nur dazu dient, dass Rollen, die eigentlich schon festlegen, diskutiert werden, können alle nur verlieren.”
Dr. Jonathan Landgrebe: “Kultur und Gesellschaft im Spiegel des Buchmarktes”
“Die Verbindung von Buch und medialer Öffentlichkeit ist essenziell”, stellte Dr. Jonathan Landgrebe, Verleger und Vorstandsvorsitzender der Suhrkamp Verlag AG, zu Beginn seines Vortrags fest. Obgleich der Buchmarkt weiterhin erfolgreich sei, stehe auch er unter Druck und vor erheblichen Herausforderungen. Landgrebe betonte, “wie eng das Buch und das Lesen verknüpft ist mit aufmerksamkeitsökonomischen Fragen”. So leide der Buchhandel unter der Abnahme und der ansteigenden Singularisierung von Kulturberichterstattung. Erschwerend kämen der Zuwachs, die Aufmerksamkeitshoheit und die Schnelllebigkeit sozialer Medien hinzu. Es werde schwieriger, Menschen mit qualitätsvollen Büchern zu erreichen: Aufmerksamkeit und Abnahmezahlen schwänden, gesellschaftliche Debatten würden von anderen Akteurinnen und Akteuren geprägt. Diese Entwicklung sieht Landgrebe mit Besorgnis. Zum einen mangle es in sozialen Netzwerden und im Online-Journalismus im Vergleich zum Medium Buch häufig an Gründlichkeit, Richtigkeit, Eindeutigkeit, Perspektivwechsel, Visualisierbarkeit und Nähe. Zum anderen beobachtet Landgrebe eine Abnahme von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Richtigkeit der Inhalte, ein Rückgang von Konzentrationsfähigkeit und Erreichbarkeit. Der Gesellschaft mangle es dadurch an gemeinsamer Literatur und Diskussionsgrundlage. Auch “die bildungsbürgerlich geprägte Gesellschaft findet nicht mehr wirklich zusammen”.
Im Suhrkamp Verlag versuche man gegenzusteuern, so Landgrebe. Der Verlag arbeite am Aufbau einer eigenen Community, das Buch solle “direkt an die Konsument:innen” gebracht werden, eine Vermarktung über soziale Medien sei notwendig und der Verlag mache sich für den Erhalt des Buchhandels in Deutschland stark. Zusätzlich betonte Jonathan Landgrebe die Relevanz des Zusammendenkens von Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik und des Nachdenkens über eine europäische Medienplattform nach eigenen ethischen und politischen Standards, wie sie vor Jahren schon der frühere Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, gefordert habe.
Prof. Dr. Sandra Richter: “Damit die Vergangenheit eine Zukunft hat”
Prof. Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, berichtete zunächst über ihre Arbeit. Das Archiv diene der “Sammlung von Literatur und allem rund um die Literatur” und habe die Erhaltung interessanter Werke zum Auftrag. Dabei seien insbesondere die Autorinnen und Autoren von Relevanz, die auf lange Sicht für die Gesellschaft und Literaturgesellschaft von Bedeutung seien. Es gehe um das “Erwerben, Erschließen, Erforschen, Vermitteln zwischen uninteressanter und interessanter Vergangenheit”. Um die ressourcenintensive Archivarbeit und Bestandserschließung durchführen zu können, gelte es “Politik und Privatpersonen für Literaturarbeit zu gewinnen”. Insbesondere in Zeiten, in denen Personalmittel und Energiekosten die Haushaltstitel für Programmatisches reduzieren, bedeute Kulturpolitik für das Deutsche Literaturarchiv im Wesentlichen “Geld für Literatur zu besorgen”.
Für die Sicherung von Kulturarbeit jenseits finanzieller Rahmenbedingungen, brachte Sandra Richter fünf Anregungen mit nach Tutzing. Es sei relevant, Kulturdaten als Infrastruktur zu verstehen, in deren Bewahrung und Erforschung zu investieren. Für das Deutsche Literaturarchiv Marbach zähle dazu auch, den Bestand so zu sichern, dass er im Krisen- oder Kriegsfall erhalten werden könne. Außerdem sei eine engere Zusammenarbeit, eine Bündelung von Ideen zwischen unterschiedlichen Ressorts, Ländern und Trägerschaften wünschenswert. Richter sprach sich zudem dafür aus, Kultureinrichtungen und ihre Freiheit so zu gestalten, dass sie “at arm´s length from government” – also außerhalb der unmittelbaren Reichweite der Regierung seien. Sie forderte eine Steigerung der Kunstfreiheit. Kultureinrichtungen sollten nicht mehr “als nachgeordnete Behörden verstanden werden”, bei denen Geldgeberinnen und Geldgeber versuchen, Einfluss auszuüben. Stattdessen benötige es Globalhaushalte, die den Kultureinrichtungen finanzielle Handlungsfreiheit ermöglichten. Für Archive sei es darüber hinaus von Relevanz die “künftige Vergangenheit” zu sichern, beispielsweise durch die Förderung von Vorlässen. Die fünfte Anregung von Prof. Dr. Richter betraf den Umgang mit jüdischem Erbe und Provenienzforschung in der Archivarbeit. Dieses wichtige Anliegen sei allerdings auch mit zusätzlichen Aufgaben verbunden. Für die Bewältigung der intensiven Erforschung benötige es mehr Ressourcen und Expertinnen und Experten: “Wir bräuchten erst einmal die Menschen, die wissen, wo jene Provenienzen liegen und diese finden. Erst dann können wir das Schiedsgericht anrufen.” Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hat zur Unterstützung seiner Arbeit die “Deutsche Literaturstiftung” gegründet.
Veronica Kaup-Hasler: “Kultur für Alle. Offene und soziale Räume der Kultur als Grundlage der Demokratie”
“Wir haben herausfordernde Zeiten, die müssen wir mit Zuversicht umarmen”, so laute das Motto von Veronica Kaup-Hasler, der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien. “Wir sehen vermehrt Angriffe auf das Gemeinsame, auf das Öffentliche, besonders auch in den sozialen Medien.” Kunst und Kultur seien essenzielle Teile, die hier zu einer Lösung beitragen können. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sehe Kaup-Hasler ihre Aufgabe als Kulturpolitikerin darin, Kunst und mit ihr soziale Räume und Orte der Begegnung zu erhalten und zu fördern (“Kultur als Agora”). Die Förderung kultureller Teilhabe sei eine wichtige Stellschraube für die Stärkung des demokratischen Zusammenlebens.
Um Kunstangebote, ihre Stärken und Funktionen fördern zu können, entwickelte die Stadt Wien die “Wiener Kulturstrategie 2030”. Dieses Konzept beschreibe acht Handlungsfelder, in denen Kulturpolitik agieren müsse. Eine zentrale Säule laute “Leistbare Kultur und inklusive Teilhabe”. So bemühe sich die Stadt Wien um eine Vielfalt an niedrigschwelligen und erschwinglichen Kulturprojekten. Kaup-Hasler stellte einige Angebote vor: von freien Dauerausstellungen in Museen über kostenlose Musik- und Wissenschaftsveranstaltungen bis hin zu “Kulturankerzentren” in verschiedenen Stadtbezirken. Dabei stehe das Kulturreferat immer auch vor Zukunftsfragen: “Wie kann die Zukunft gestaltet werden? Wie können Kinder erreicht und begeistert werden, möglichst kostengünstig, um niemanden auszuschließen?” Als weitere wichtige Anliegen ihrer Arbeit nannte Kaup-Hasler den Schutz jüdischen Lebens, die Förderung von Erinnerungskultur und die Gewährleistung einer fairen Vergütung von Kunstschaffenden. Obgleich auch die Stadt Wien finanziell unter Druck stehe, gelte es, sich für gewinnbringende Umsetzungsformen der eigenen Überzeugungen zu engagieren: “Wir haben kein Recht, für die neue Generation Depression zu verbreiten, wir müssen an der Zuversicht arbeiten.”
Dr. Julia Encke: “Kulturjournalismus, Kulturpolitik, Kulturkampf”
“Reflektieren, was war, was ist, was sein könnte”, so fasst Dr. Julia Encke die Aufgabe des Feuilletons zusammen. In ihrem Impuls zum Thema “Kulturjournalismus, Kulturpolitik, Kulturkampf” schilderte die verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) in Berlin anhand eines exemplarischen Arbeitstages Herausforderungen im Kulturjournalismus. Herausgegriffen hatte sie sich dafür den 17. Juni 2025. An diesem Tag zeigte sich, wie rasch sich Falschmeldungen verbreiten – nicht nur im Netz, sondern auch in journalistischen Medien. Ein Rowohlt-Fake-Account hatte gemeldet: “Elfriede Jelinek ist tot”. Entgegen journalistischer Standards meldeten einige Medien diese Nachricht, die sich der italienische Aktivist Tommaso Debenedetti ausgedacht hatte. Seit vielen Jahren verbreitet der italienische Autor, Lehrer und langjährige Fake-News-Aktivist Falschmeldungen, um die Medien in ihrer Breaking-News-Mentalität vorzuführen. Encke konnte diese Nachricht nach einer Überprüfung der Quellen und durch Gegenchecken schnell als Unwahrheit erkennen. Am selben Tag erreichte ihre Redaktion ein Leserbrief, der ihr fälschlicherweise die Verwendung von Künstlicher Intelligenz und deren fehlende Kennzeichnung vorwarf. Das Vertrauen in die Gründlichkeit journalistischer Arbeit sinke, stellte Encke fest. Zumindest in Teilen sei das auch selbstverschuldet. Und noch weitere Themen, die Grundfragen der aktuellen Debatten um Journalismus ansprechen, erreichten sie an diesem Tag: etwa das Thema Machtkonzentration und Kulturkampfdebatten im Journalismus (anhand des Beispiels der Neuauflage der “Weltbühne” durch “Berliner Zeitung”-Verleger Holger Friedrich) oder auch die Frage, wie viel Nähe zur Politik dem Journalismus ansteht.
“Die Diagnosen, dass Medien in Bedrängnis sind, sind sicher richtig”, schlussfolgerte Dr. Julia Encke. Dennoch warnte sie vor generalisierten Warnungen vor Online-Journalismus und Online-Medien: “Dadurch schaden wir dem Journalismus selbst, den es seriös sehr wohl auch online gibt.” Sie plädierte viel mehr für einen differenzierten Blick, Unterscheidung und Kreativität bei der Suche nach Lösungen.
Prof. Dr. Daniel Hess – “Museum im Brennpunkt: Kulturelle Reservate oder Survival Camps?”
“Mehr und heftiger als je stehen Museen unter Druck”, fasste Prof. Dr. Daniel Hess, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, zu Beginn seines Vortrags die aktuelle Situation zusammen. Es gebe auf der einen Seite Menschen, die sich von Museen einen vertrauten Raum ohne viele Veränderungen wünschen. Auf der anderen Seite stünden Menschen, die sich im Hinblick auf Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit eine Neuorientierung der Museen wünschen. Museen seien “Reservate des Austausches”, Orte ethischer Gerechtigkeit und Humanismus. Forderungen nach einer Neuausrichtung und Vorbildfunktion von Museen seien demnach verständlich, stellten diese aber auch vor Herausforderungen: das Personal müsse sich in neue Themen einarbeiten, zusätzliche Aufgaben erfüllen und “Museen werden zu Dauerbaustellen”. Hess vermisst in der Bewältigung dieser Anforderungen politische Unterstützung. Zum einen erschwerten Eingriffe durch Umstrukturierungsmaßnahmen und eingeschränkte gestalterische Freiheiten die Arbeit des Fachpersonals. Zum anderen stärkten politische Forderungen nach mehr Eigenständigkeit von Kulturinstitutionen ohne das Vorliegen zentraler Konzepte und Strategien, Befürchtungen von Museumsverantwortlichen, vermehrt auf sich allein gestellt zu sein.
Museen stünden unter Druck, nähmen jedoch auch wichtige Rollen in der Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforderungen wahr. Daniel Hess schilderte zwei genauer:
So beobachte er eine wachsende “Unsicherheit, wie man mit den Schattenseiten der eigenen Kultur angemessen umgehen soll”. Das Unbehagen am kulturellen Erbe sei jedoch Bestandteil der kulturellen Weitergabe selbst, so Hess. Museen könnten als Orte des “Verstehens von Welt” und der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit Orientierung in der Erarbeitung eines sichereren Umgangs bieten.
Darüber hinaus könnten Museen unter Beibehaltung ihrer historischen Tradition am gesellschaftlichen Diskurs partizipieren, diesen vertiefen und anregen. Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg kuratierte beispielsweise in den letzten Jahren Sonderausstellungen zu Streitthemen wie Migration und Umweltschutz. Die Einordnung aktueller Debatten in einen gesamthistorischen Zusammenhang könne sowohl die Dimension eines Themas als auch Veränderungen im gesellschaftlichen Umgang mit diesem aufzeigen. Der soziale Diskurs könne zudem von der Präsentation von Lösungsversuchen früherer Generationen profitieren. Es könne eine “Kultur des Wissens, der Begegnung” geschaffen werden.
Durch das Schaffen von Begegnungsräumen und der Konfrontation mit anderen Perspektiven, seien Besucherinnen und Besucher von Museen immer wieder zum Abgleich ihres Blickwinkels herausgefordert. Auch Museen prägten auf diesem Wege das demokratische Miteinander in der Bundesrepublik, so Daniel Hess.
Ulrich Khuon: “Theater im Brennpunkt”
“Was man will, liegt viel verborgener, als man denkt – und das zusammen herauszufinden, ist eigentlich das Spannende.” Die Kultur biete mit ihrer Neugier, ihrer Offenheit und ihrer Lust zur Begeisterung großen Mehrwert – für das Individuum und die Gesellschaft, so Ulrich Khuon, Intendant am Schauspielhaus Zürich. “Die Künste haben eine transzendente Qualität, sie wollen über sich hinaus.” Dieser Mehrwert, dieser Wille neue Menschen zu erreichen, sei aber herausgefordert. So leide auch die Welt des Theaters unter dem Rückgang des Rezensionswesen in Online- und Printmedien. Ulrich Khuon schließt sich einer Einschätzung des Kulturjournalisten Tobi Müller an, nach der das Theater in einem Umbruch steckt und in zwei Arten künstlerischen Schaffens eingeteilt werden könne: “Die einen wollen künstlerisch arbeiten und konfrontieren, provozieren, die anderen haben Angst vor Konfrontation und gleichen sich an.” Für Ulrich Khuon sei Rückzug aufgrund von Verunsicherung oder Resignation durch zurückgehendes politisches oder junges Interesse der falsche Weg. Vielmehr plädierte er für das Herstellen einer Balance “zwischen Angst und Hochmut” und für das Arbeiten für und an der Zukunft des Theaters. Dafür benötige es aktives lokales und politisches Agieren. “Es hat keinen Sinn dieses Desinteresse zu akzeptieren, wir müssen uns gewissermaßen aufdrängen.”
Kunst und Kultur sollten explizite Angebote für junge Menschen schaffen, die an ihrer Lebensrealität anschließen, in ihren Räumen stattfinden und zur Mitarbeit anregen. Ulrich Khuon räumte ein: Die Herausforderungen im Kulturbereich seien groß, gerade im Theaterbereich herrsche oft Orientierungslosigkeit oder Unsicherheit. Für einen Zugewinn an Stabilität sei auch das Abbauen von Berührungsängsten zwischen verschiedenen Kulturbranchen unabdingbar. Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung seien relevant für wirksames kulturpolitisches Auftreten. Dann sei man “immer noch allein, aber man ist es zusammen.”
Mit Blick auf die Zivilgesellschaft beobachte Khuon eine “nervöse und gereizte, polarisierte Gesellschaft”, der es an Erlebnisräumen mangle. Gerade das Theater könne hier Abhilfe schaffen. “Erleben ist wichtiger als Reflektieren. Es ist wichtig, dass wir erleben und nicht Denkanstöße bekommen, denn Denkanstöße bekommen wir den ganzen Tag und kommen ja damit nicht weiter.” Für das Zusammenleben in Vielfalt und Demokratie biete der Erlebnisraum, den das Theater eröffne, eine Chance: ein “Raum, den man öffnet, größere Schlüsse zu ziehen, ist von zentraler Bedeutung.”
Schlussbetrachtung: Roger de Weck
Zum Ende der Tagung “Kulturpolitik, Kulturjournalismus, Kulturkampf” beschrieb der Leiter des Politischen Clubs, Roger de Weck, “die Suche nach neuen Wegen” als das Leitmotiv der Tagung. Es benötige neue Wege im Organisatorischem und Institutionellen auf allen Seiten – Kultur, Medien und Politik. Die Kulturinstitutionen benötigten mehr Vertrauen und Gestaltungsfreiheit, auch in Form von globalen Budgets für unabhängiges Handeln. Wenn Kultur als Agora, als Ort der Begegnung und der “Suche nach Dialog” verstanden würde, würden Perspektivwechsel und neue Gemeinschaft möglich. Für eine zuversichtliche Bearbeitung von Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Kulturlandschaft benötige es zudem “langsames, differenziertes Denken”, “kritisches Lesen und Diskutieren” und ein Mehr an ressort- und branchenübergreifender Zusammenarbeit.
Johanna Uhrich / dgr
Bild: Während des Vortrags von Veronica Kaup-Hasler (Foto: dgr/eat archiv)