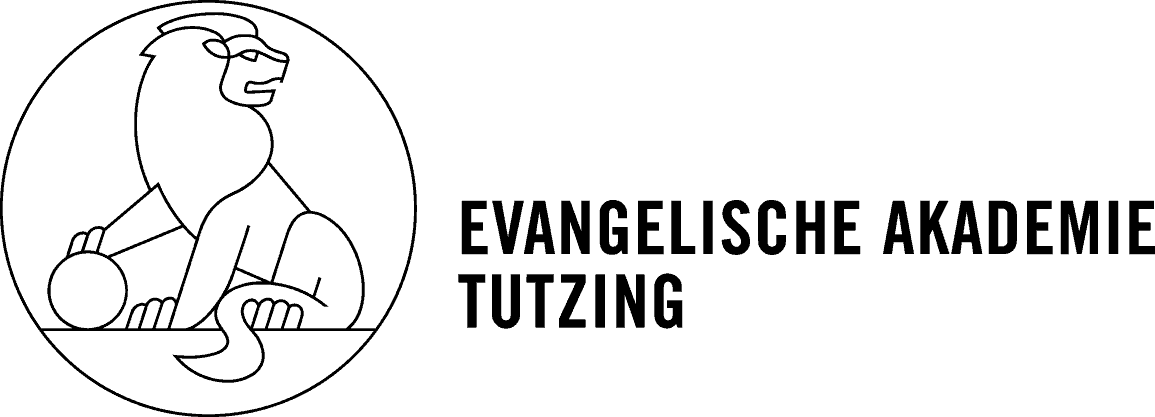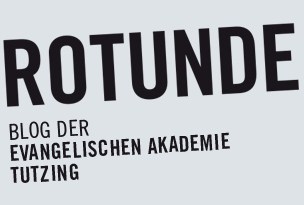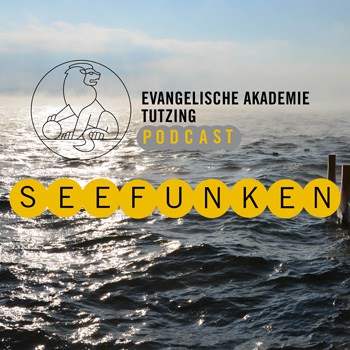Bildergalerie: “Kulturpolitik, Kulturjournalismus, Kulturkampf”
von Pressestelle × am 2. Juli 2025“Die Suche nach neuen Wegen” – unter diesem Leitmotiv fasste Roger de Weck den Austausch in der Sommertagung des Politischen Clubs im Juni 2025 zusammen. Inhaltliche und bildliche Eindrücke aus der Tagung “Kulturpolitik, Kulturjournalismus, Kulturkampf” finden Sie in dieser Bildergalerie.
→ Zum ausführlichen Tagungsbericht geht es hier.
Das Programm der Tagung können Sie hier abrufen.
Texte & Bilder: Dorothea Grass
Aufmacherbild: Akademiedirektor Udo Hahn, Moderatorin Sybille Giel und Roger de Weck, Leiter des Politischen Clubs.

Der Leiter des Politischen Clubs, Dr. h.c. mult. Roger de Weck, neben Akademiedirektor Udo Hahn (links im Bild). Beide verantworten die Inhalte des ältesten und renommiertesten Tagungsformats der Evangelischen Akademie Tutzing.
In seiner Begrüßung zur Sommertagung vom 20.-22. Juni 2025 ging Udo Hahn auf einen Brief Dietrich Bonhoeffers an einen Freund ein. Bonhoeffer schrieb aus dem Gefängnis: “Kultur ist der Spielraum der Freiheit”. Mit diesem Zitat leitete Hahn auf das Thema der Tagung hin. Es brauche Ressourcen und die innere und äußere Freiheit, sich mit Kultur zu beschäftigen.
Roger de Weck griff den Freiheitsbegriff Bonhoeffers in seiner Einführung auf und ging auf den Spannungsbogen der Tagung ein: Kulturpolitik, Kulturjournalismus, Kulturkampf – mit verschiedenen Säulen wie etwa Institutionen und Förderung, aber auch Fragestellungen zu Zuständigkeiten, Kulturbegriff, Kulturvermittlung, Medien, rechtliche und technologische Rahmenbedingungen (KI) und Sozialpolitik. “Es erschwert die die Kulturpolitik, wenn sie Kulturkampfpolitik sein soll.”, sagte de Weck.

“Welchen Platz hat die Kultur in der digitalen Medienwelt?”, das war die Frage, auf die Björn Wilhelm (links im Bild neben Roger de Weck), Kulturprogrammdirektor beim Bayerischen Rundfunk, in seinem Vortrag einging. Er plädierte für ein “neues Selbstverständnis ohne Berührungsängste”. In Partnerschaften und Netzwerken können Medien, Kulturschaffende, Institutionen und Kulturpolitik sich gegenseitig mehr Vertrauen und Verständnis für die gegenseitigen Bedürfnisse entgegenbringen.

Prof. Dr. Daniel Hess, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, hatte seinen Vortrag mit den Worten “Museum im Brennpunkt: Kulturelle Reservate oder Survival Camps?” überschrieben.
Er stellte fest: “Mehr und heftiger als je stehen Museen unter Druck.” Immer mehr greife die Politik in die Museen ein, die Museen selbst sollten dabei “eigenständiger” werden, konkret bedeute das: weniger finanzielle Mittel, weniger Struktur. Für Hess sind Museen gesellschaftlich relevante Orte: in der Auseinandersetzung, Aufarbeitung und Kontextualisierung geschichtlicher Exponate ginge es auch darum Ambivalenzen, Differenzen und Widersprüche auszuhalten. All das seien auch Merkmale von Demokratie.

Debatten bei geöffneten Türen und sommerlichen Temperaturen: Blick in die Rotunde der Evangelischen Akademie Tutzing.

Dr. Jonathan Landgrebe ist Verleger und Vorstandsvorsitzender des Suhrkamp Verlags in Berlin. Er sprach über “Kultur und Gesellschaft im Spiegel des Buchmarktes” und ging dabei vor allem auf Fragen der Aufmerksamkeitsökonomie und ihre Folgen für den Buchmarkt ein. Die Branche reagiere darauf, in dem sie eigene Communitys aufbaue und Bücher direkt an die Leserschaft vermarkte. Ein weiteres Anliegen ist ihm der Erhalt von Buchhandlungen.
Landgrebe sprach sich dafür aus, Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik zusammenzudenken. Eine eigene europäische Medienplattform nach ethischen und politischen Standards, wie sie Ulrich Wilhelm schon vor Jahren gefordert habe, hält auch Landgrebe für sinnvoll.
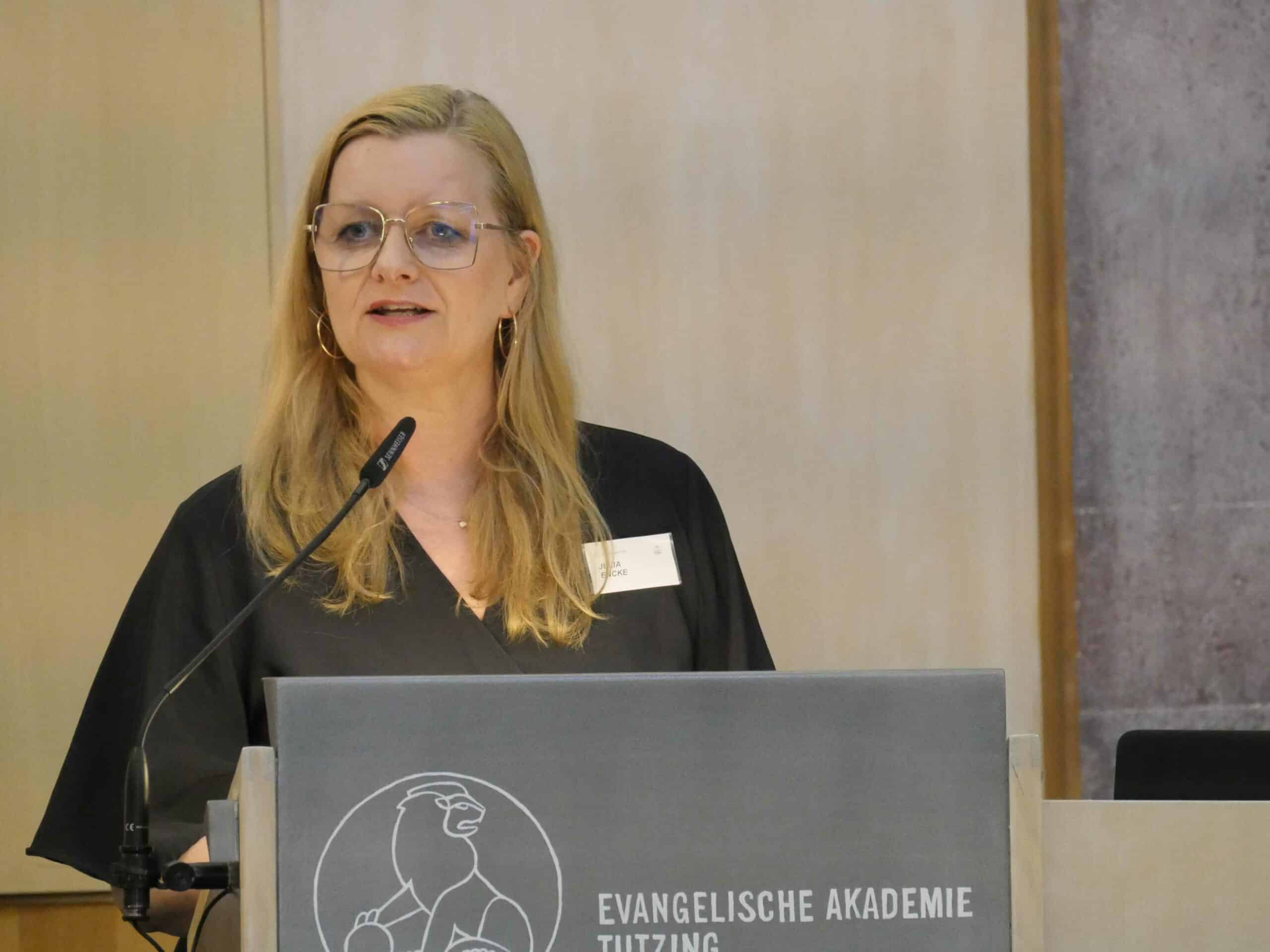
Dr. Julia Encke, verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, schilderte in ihrem Impuls zum Tagungsthema exemplarisch den Verlauf eines Arbeitstages. Darin vorkommend: der Umgang mit einer Falschmeldung (“Elfriede Jelinek ist tot”), ein Leserbrief mit dem Vorwurf, ChatGPT habe ein Interview geschrieben, das in ihrer Zeitung abgedruckt wurde sowie das Thema Machtkonzentration und Kulturkampfdebatten im Journalismus (anhand des Beispiels der Neuauflage der “Weltbühne” durch “Berliner Zeitung”-Verleger Holger Friedrich).
“Die Diagnosen, dass Medien in Bedrängnis sind, sind sicher richtig”, sagte Encke. Generalisierten Warnungen vor Online-Journalismus und Online-Medien helfen hier jedoch nicht weiter. Encke plädierte für einen differenzierten Blick und Kreativität bei der Suche nach Lösungen.

“Kultur und Demokratie: Vom Wert des Imaginären” war der Titel des Vortrags von Dr. Kia Vahland, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung (Schwerpunkte: Kunst, Kultur, Geschichte und Politik) und aktuell Junior Fellow am Alfried Krupp Wissenschaftskolleg in Greifswald.
Kultur umschließe und verarbeite das Imaginäre, so Vahland. Kultur eröffne Denkräume und schaffe eine Distanz zwischen dem Menschen und dem Kunstwerk. Dadurch werde es möglich, verschiedene Wahrnehmungen untereinander abzugleichen – und auch Fiktion von Realität zu unterscheiden. Sie plädierte für einen freiheitlichen Kulturbegriff, stellte aber auch klar, dass Kultur nicht dazu dienen dürfe, Demokratie zu erklären. Aus schöpferischer Sicht sei die aktuelle Epoche von großer Bedeutung.

Patrick Bahners, Feuilletonredakteur und verantwortlich für das Ressort “Geisteswissenschaften” der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, konzentrierte sich in seinem Vortrag auf das Thema “Geschichtskultur und Anti-Antisemitismus”.
Wie sich Kulturkampf anhand von Topoi, rhetorischen Strategien aber auch sachlichen Auseinandersetzungen manifestieren kann, zeigte er anhand eines Beispiels aus dem Jahr 1976. Damals veröffentlichte der Suhrkamp-Verlag das Theaterstück von Rainer Werner Fassbinder “Der Müll, die Stadt und der Tod”. Die Publikation löste eine lange Debatte aus, vor allem eine Rezension von Joachim Fest, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Leiter des Feuilletons, sollte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Dr. Konrad Schmidt-Werthern, Leitender Beamter beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und auf diesem Bild im Austausch mit Roger de Weck, ging auf die Ziele der aktuellen Kulturpolitik ein. Dazu gehören unter anderem: Medienvielfalt sichern, Niveau der Kulturförderung auf Bundesebene halten, Institutionen mehr Freiheit geben, mehr Gewicht auf europäische Zusammenarbeit.
Kultur spiele eine wichtige Rolle für das demokratische Zusammenleben, so Schmidt-Werthern: “Kunst und Demokratie bedingen einander, sie brauchen den offenen Raum der Freiheit. Und so misst Kultur nicht nur die Temperatur der Freiheit, sondern sie gestaltet auch diese.”
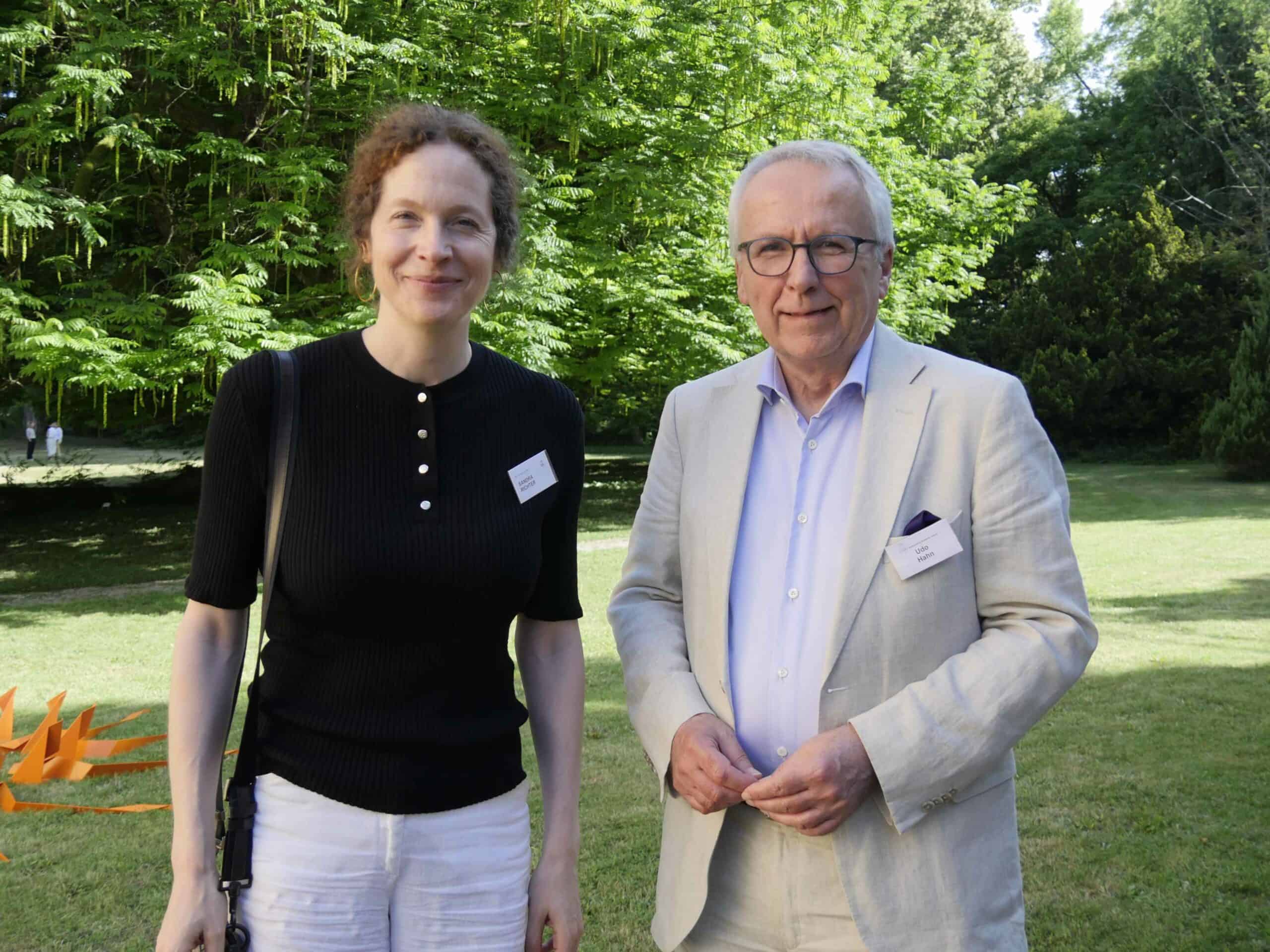
“Damit die Vergangenheit eine Zukunft hat” lautete der Titel des Vortrags von Prof. Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach (auf dem Bild neben Akademiedirektor Udo Hahn). Sie ging darin vor allem auf strukturpolitische und verwaltungstechnische Aspekte sowie ihre Auswirkungen auf die Arbeit kultureller Institutionen ein. Ihre Forderungen konzentrieren sich auf fünf Punkte: mehr digitalisieren, ressort- und länderübergreifend denken, Kulturfreiheit umsetzen, künftige Vergangenheit sichern (Archive) sowie mehr Ressourcen im Hinblick auf jüdisches Erbe und Provenienzforschung.

“Theater im Brennpunkt” war das Thema von Ulrich Khuon, Intendant am Schausspielhaus Zürich. In seinem Vortrag kritisierte er sowohl die schwindende Berichterstattung als auch das Desinteresse von Stadt- und Kommunalpolitik am Theatergeschehen. Darüber hinaus sei aber auch das Theater selbst im Umbruch. Rückzug oder Resignation dürfe jedoch keine Option für Kunst- und Kulturschaffende sein. Jeder Mensch habe den Wunsch, über sich hinaus gehen zu können – diese “transzendente Qualität” sei es, die das Theater ausmache. Er forderte seine eigene Zunft auf, (lokal und politisch) relevante Themen aufzugreifen, in den Austausch mit jungen Generationen zu gehen und die Zusammenarbeit kultureller Einrichtungen auszubauen und zu verstärken.

Aus Wien war Magistra Veronica Kaup-Hasler nach Tutzing gereist. Sie berichtete unter dem Titel “Kultur für Alle. Offene und soziale Räume der Kultur als Grundlage der Demokratie” aus ihrer Arbeit als amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien. Dabei ging sie unter anderem auf Gratis-Museenangebote ein, den “Kultursommer Wien”, “Bezirksmuseen reloaded”, “Kulturankerzentren”, Umnutzungen vorhandener Häuser und Räume für Kunst und Kultur als auch auf die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit ein.
Kultur könne nicht das reparieren, was in der Politik schief laufe, aber ermögliche Räume des Gemeinsamen und des Miteinander-Redens. Sie warb für mehr Zuversicht und ein Verständnis von “Kultur als Agora”.

In seinem Resümee beschrieb Roger de Weck, “die Suche nach neuen Wegen” als Leitmotiv der Tagung. Sowohl organisatorisch als auch institutionellen seien Kultur, Medien und Politik aufgefordert, neue Wege zu gehen und ressort- und branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Europäische Plattformen zu etablieren sei ebenso notwendig wie das Bemühen um Dialog, Zuversicht, langsames und präzises Denken, Bewusstsein für den Kampf um Aufmerksamkeit und die Herausfordeungen und Chancen durch Künstliche Intelligenz.