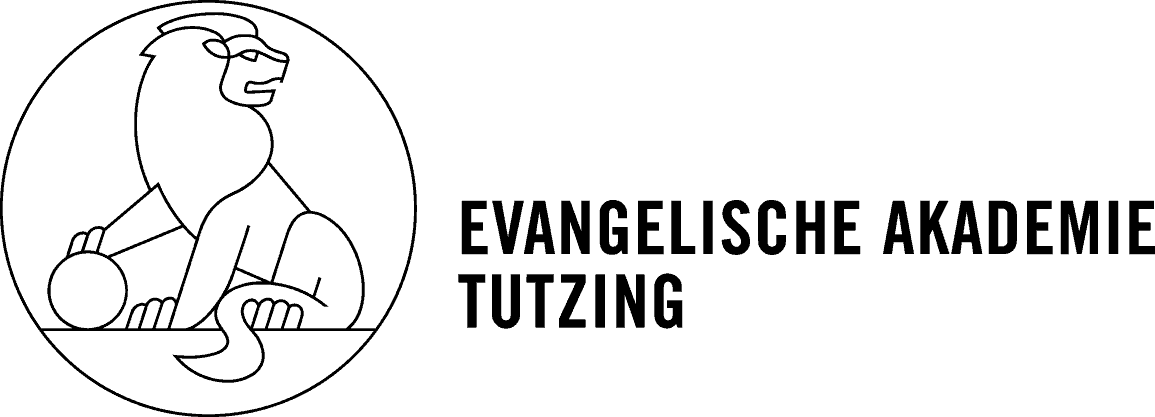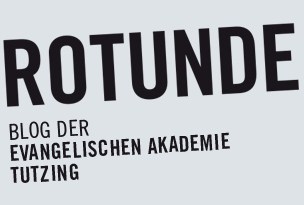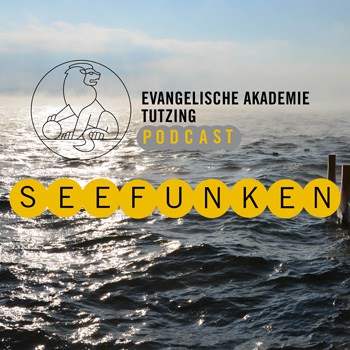Wer macht uns morgen den Hof? Landwirtschaft in der Gegenwart
Wir diskutieren heute kritischer über Landwirtschaft als noch vor einigen Jahrzehnten. Woher unsere Nahrung kommt, ist auch zu einer moralischen Frage geworden. Das hat auch Auswirkungen auf die Landwirte und Landwirtinnen und den gesellschaftlichen Blick auf ihren Berufstand.
Von Christian Dürnberger
Landwirtschaft ist umstritten: Die entsprechenden Debatten drehen sich um Tierquälerei, Umweltverschmutzung, Klimakrise, Glyphosat oder auch den Einsatz von Antibiotika, um nur einige, wenige Themen zu nennen. Darüber hinaus stellt sich mit Blick auf die Nutztierhaltung die grundsätzliche Frage, inwieweit es moralisch rechtfertigbar ist, Tiere zu halten, um sie zu schlachten und zu essen. Kurzum: Wir diskutieren heute anders – und zwar kritischer – über Landwirtschaft als noch vor einigen Jahrzehnten. Woran liegt das? Eine erste, keineswegs erschöpfende, Erklärung verweist auf die simple Tatsache, dass wir satt sind. Historisch und auch geographisch gesehen ist dies eine relativ seltene Situation in der Menschheitsgeschichte, die zweifelsohne die Diskurse verändert, denn wer keinen Hunger leidet und Nahrungsmittel jederzeit in einem gut gefüllten Supermarkt erstehen kann, dessen Erwartungshaltung ändert sich. “Essen”wird von einer Frage der persönlichen Präferenz (Was macht mich satt? Was schmeckt mir? Was kann ich mir leisten? Was tut mir gut?) nicht zuletzt zu einer moralischen Frage: Wie wirkt sich das, was auf meinem Teller liegt, auf Umwelt, Klima, Tiere und Region aus? Es ist jedoch davor zu warnen, die Forderungen nach mehr Umwelt-, Klima-, und Tierschutz als eine bloße “Luxusdebatte”abzutun. Ja, es braucht in der Tat einen gewissen Wohlstand, um Debatten wie beispielsweise jene rund um das „Tierwohl“ zu führen. In anderen Worten: Würde zurzeit eine Hungersnot in Europa herrschen, wäre davon auszugehen, dass wir nicht darüber diskutierten, wie viel Quadratmeter ein Schwein in seinem Stall zur Verfügung haben soll. Wir hätten andere, dringendere Probleme. Jedoch ist es nicht zu leugnen, dass wir zurzeit – immer noch – in Wohlstand leben, und wenn ein solcher Wohlstand erreicht wurde, muss über Werte jenseits der Ernährungssicherheit nachgedacht werden. Damit sind all die Diskussionen rund um Umwelt, Klima und Tiere hochnotwendige Auseinandersetzungen – und eben keine “Luxusdebatten” im Sinne von “verschwenderisch”oder “sinnlos”.
Es gibt zweifellos noch weitere Gründe, warum wir heute anders über Landwirtschaft diskutieren als in früheren Generationen, man denke beispielhaft an den Problemdruck durch die Klimakrise, den niedrigen Wissensstand breiter Teile der Gesellschaft über landwirtschaftliche Arbeit oder auch das neu gewonnene, naturwissenschaftlich-basierte Wissen über die Skills und Bedürfnisse unserer (Nutz-)Tiere. All dies soll im Folgenden jedoch nicht im Fokus stehen, vielmehr soll es um eine professionsethische Frage gehen, die weitgehend vernachlässigt wird, nämlich: Was machen diese Debatten und diese neuen Forderungen mit den Menschen, die diese Arbeit verrichten? Anders formuliert: Was bedeutet es heute, Bauer bzw. Bäuerin zu sein?
Ein Beruf, der zum Small-Talk passt?
Ich möchte dabei eine Beobachtung wiedergeben, die mir in den vergangenen zehn Jahren, in denen ich zahlreiche Workshops mit Landwirten und Landwirtinnen durchgeführt habe, immer wieder untergekommen ist. In einem Artikel, an dem ich gerade schreibe, fasse ich diese Beobachtung wie folgt zusammen: “An einem Samstagabend lernen sich ein junger Mann und eine junge Frau auf einem Fest kennen. Man kommt ins Gespräch und stellt sich die üblichen Fragen, als die Unterhaltung jedoch auf den Beruf kommt, verstummt der Mann. Er braucht ein paar Augenblicke, dann wechselt er mit einer launigen Bemerkung das Thema. ‘Ich bin durchaus stolz auf das, was ich beruflich mache, aber ich würde es erst bei einem zweiten oder dritten Date erzählen’, sagt der Mann ein paar Wochen später während eines Workshops unter Kolleginnen und Kollegen. ‘Unser Beruf passt einfach nicht zu einem harmlosen Small-Talk. Und schon gar nicht zu einem Flirt an einem Samstagabend.’ Der Workshop richtete sich an tierhaltende Landwirtinnen und Landwirte. Der junge Mann bezeichnete sich in der Vorstellungsrunde selbst als ‘Schweinebauer’. Die geschilderte Szene wirft die Frage auf, inwieweit sie mehr als eine bloße Anekdote beinhaltet: Da ist jemand in der Landwirtschaft, genauer in der Nutztierhaltung tätig, verschweigt dies aber in bestimmten Situationen lieber. Warum? Ist dieses Verhalten typisch für den Berufsstand zu nennen? Wenn ja, seit wann und auf Basis welcher Entwicklungen? Verschweigt der junge Mann hier etwas, worüber sein Großvater möglicherweise noch stolz erzählt hätte? Anders formuliert: Inwieweit vermag uns die geschilderte Szene etwas über eine mögliche Transformation der Nahrungsmittelproduktion – aus Sicht der Praktikerinnen und Praktiker – zu berichten?” (Dürnberger 2025)
Ist dieses Verstummen nicht bloß anekdotisch und zufällig, ist näher darüber nachzudenken. Im berufssoziologischen Konzept “Dirty Work” im Anschluss an den US-amerikanischen Soziologen Everett C. Hughes findet man eine potenzielle Antwort: Hughes interessierte sich für Berufe, die gemeinhin wenig Ansehen aufweisen und die gesellschaftlich weitgehend lieber ausgeblendet werden, die also nicht unbedingt als Small-Talk Thema taugen. Er spricht hierbei von “Dirty Work”, also “Drecksarbeit”. Er argumentiert dabei nicht, dass bestimmte Tätigkeiten weniger geachtet werden sollen als andere, stattdessen gilt sein Interesse dem gesellschaftlichen, aber auch individuellen Blick auf diese Berufsfelder. Sprich: Manche Berufe haben ein hohes Prestige – andere nicht. Manche taugen als Small-Talk Thema – andere weniger. Hughes diagnostiziert, dass es vor allem Berufe sind, die entweder als ekelig (z.B. Kanalarbeiter oder Toiletten-Reinigungskräfte) oder als moralisch zweifelhaft (z.B. Bordellbesitzer) wahrgenommen werden, die dazu führen, dass Berufsangehörige diese Arbeit in bestimmten gesellschaftlichen Settings lieber verschweigen.
Was bedeutet es, Landwirtschaft zu betreiben?
Hughes entwickelte seine Theorie in den 1950er Jahren. Landwirtschaft spielte in seinen Arbeiten keine Rolle, und doch stellt sich einige Jahrzehnte danach die Frage, ob zentrale Elemente seines Ansatzes nicht auch auf die Arbeit von Bauern und Bäuerinnen in der Gegenwart zutreffen, sprich, ob (nutztierhaltende) Landwirtschaft gegenwärtig als eine Art von “Drecksarbeit” im Sinne von Hughes beschrieben werden kann – und vielleicht sogar muss? In diesem Kontext kann beispielsweise auf eine Studie unter Nutztierhalterinnen und Nutztierhaltern verwiesen werden, welche die Erfahrungen dieser Berufsgruppe auf Facebook untersuchte (vgl. Dürnberger 2019). Die befragten Landwirtinnen und Landwirte kamen dabei wiederholend darauf zu sprechen, dass sie auf der Social-Media-Plattform wegen ihres Berufes heftig kritisiert und beleidigt werden und sie sich wie “am moralischen Pranger” fühlen.
Was bedeutet es, Landwirtschaft zu betreiben? Da ist der “stolze”, “altehrwürdige” Beruf des Bauern, der Bäuerin, ein Beruf, der uns ernährt und ohne Zweifel zu den wichtigsten Berufen einer jeden Gesellschaft zählt – aber da ist eben auch die andere Seite des Berufsbildes, welche einen jungen Mann offensichtlich dazu bringt, lieber nicht über seine Arbeit zu sprechen. Dieser Beitrag plädiert dafür, diese Sichtweise nicht auszublenden, wenn es um das Selbstverständnis, die adäquate Vorbereitung auf den Beruf in der Ausbildung und die grundsätzliche Attraktivität des Berufes geht. Anders formuliert: Bei der Frage, wer uns zukünftig (noch) “den Hof machen will”, ist es ratsam, auch jene Perspektive zu berücksichtigen, die Landwirtschaft potenziell als “Drecksarbeit” beschreibt.
Literatur
- Dürnberger, Christian (2019): ‘You should be slaughtered!’ Experiences of criticism/hate speech, motives and strategies among German-speaking livestock farmers using social media. International Journal of Livestock Production 10(5), 151-165.
- Dürnberger, Christian (2025 – in press): Landwirtschaft als Drecksarbeit? Nutztierhaltung zwischen Unsittlichkeit und Unschicklichkeit in einer ultra-zivilisierten Gesellschaft.
Über den Autor:
Dr. Christian Dürnberger ist Philosoph und Kommunikationswissenschaftler. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf Fragen der angewandten Ethik in der Landwirtschaft wie der Veterinärmedizin. Er arbeitet als Universitätsassistent am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Mehr über den Autor finden Sie auf seiner Homepage www.christianduernberger.at.
Hinweis:
Dr. Christian Dürnberger ist Kooperationspartner unserer Tagung “Bauer – Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?”, die vom 17. – 18. März 2025 an der Evangelischen Akademie Tutzing stattfindet und die sich mit dem Berufsverständnis des modernen Landwirts im Spiegel gesellschaftlicher Erwartungen auseinandersetzt. Alle Informationen zur Tagung sind auf der Homepage der Evangelischen Akademie Tutzing abrufbar.
Bild: Christian Dürnberger (Foto: Thomas Suchanek, Vetmeduni Vienna)