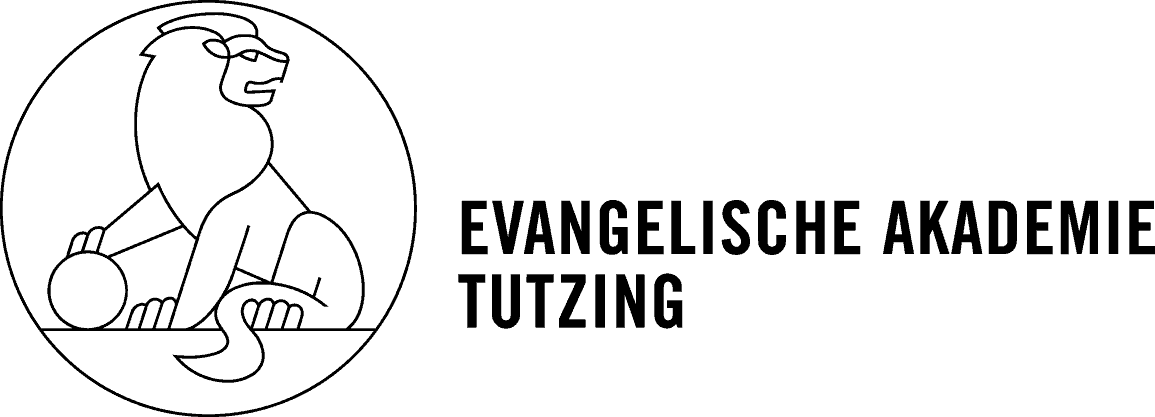Tagungsbericht “Deutsche Einheit, deutsche Teilung”
80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und etwa vier Wochen nach den Bundestagswahlen fühlte die Frühjahrstagung des Politischen Clubs vom 21. – 23. März 2025 2025 den Puls der einst geteilten und heute wiedervereinten Republik.
→ Bildergalerie der Tagung hier abrufen
→ Videos aus der Tagung hier ansehen
Über die Tagespolitik hinaus zeichnete die Tagung den langen Weg Deutschlands nach 1945 nach: im Dialog zwischen Ost und West, Alt und Jung, Politik und Gesellschaft. Dabei ging es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie um die Frage: Wie lässt sich Einheit in der Vielfalt gestalten?
In seiner Einführung sprach der Leiter des politischen Clubs, Roger de Weck, davon, einen „Rückblick nach vorn“ wagen zu wollen. Er bezog sich in seinem Eingangsstatement auf Deutschland als Nation nach dem Zweiten Weltkrieg. Das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche sei in der Geschichte Deutschlands nicht voneinander zu trennen.
Neben den verschiedenen Perspektiven, deutsch-deutschen Lebensbiografien, ost- und westdeutschen Erfahrungswelten sowie politischen und geschichtlichen Entwicklungen tauchten zwei Themen während der Tagung immer wieder als Konfliktlinien auf, die die politische Stimmung im Land spiegelten: die Stimmengewinne der AfD bei den Bundestagswahlen im Februar und der Umgang mit der Partei – sowie der Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Im Gespräch mit Tagungsleiter Dr. h.c. mult. Roger de Weck kritisierte die Publizistin Dr. Franziska Augstein die Parteinahme Europas zugunsten der Ukraine im Konflikt mit Russland. Auch bemängelte sie, es habe bislang zu wenig diplomatische Unterfangen gegeben, den Krieg zu beenden. Was sie derzeit wahrnehme, sei eine Diktion wie vor dem Ersten Weltkrieg. Augstein bezog sich auf den aktuellen „Annual threat assessment report“, der festgestellt habe, dass momentan keine Kriegsgefahr für Europa von Russland ausgehe. Auch sehe sie Wladimir Putin nicht als Imperialisten.
Ausgehend von dem „Nie wieder!“ nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Augstein die Frage: Meint ein „Nie wieder“ „Nie wieder Krieg“ oder „Nie wieder Unterdrückung“? Hierüber gebe es unterschiedliche Auffassungen. Zu wenig Unterscheidung nehme sie dagegen hinsichtlich der Frage wahr, ob die Aufrüstung das Ziel habe, Deutschland „verteidigungsfähig“ oder „kriegstüchtig“ zu machen.
Ihr journalistischer Kollege, Publizist, Autor und Jurist Prof. Dr. Heribert Prantl, stimmte mit Augstein in vielem überein. Man müsse auch mit denjenigen verhandeln, die anderer Meinung sind – selbst mit Autokraten. In das Zentrum seines Vortrags stellte er das Friedensgebot des Grundgesetzes und stellte die Frage, ob es einen Verfassungswandel gegeben habe. Das Friedensgebot stehe in der Präambel und verlange, dem Frieden in der Welt zu dienen. Jedoch werde es wie eine Verzierung behandelt. „Die Verfassungsrichter schleichen derzeit am Friedensgebot vorbei“, kritisierte Prantl. Er forderte eine neue Friedensbewegung, eine Utopie der „Friedenstüchtigkeit in kriegerischen Zeiten“. „Erst wenn der Geist des Krieges besiegt ist, wird es keinen Krieg mehr geben.“, so Prantl. Auch das Friedensprojekt Europa, das lange als selbstverständlich gegolten habe, müsse wieder neu erarbeitet werden.
Der Schriftsteller Marko Martin vertrat dagegen die Ansicht: „Das Friedliche ist allein mit friedlichen Mitteln nicht durchzusetzen.“ Er äußerte Verständnis dafür, der Ukraine in ihrer Verteidigung auch mit militärischen Mitteln beizustehen und zeigte sich „irritiert über die unglaubliche Naivität“ von manchen Progressiven. „Das abstrahierende Friedensgesummse hat Konsequenzen.“, warnte Martin.
In seinem Vortrag, der den Titel „Das seltsame Westdeutschland“ trug, teilte er seine Erfahrungen als jemand, der im Osten Deutschlands aufgewachsen ist und als junger Mann in den Westen Deutschlands übersiedelte. „Der Osten“ sei aus mehreren Gründen bis heute anders als der Westen: Er besitze unter anderem ein autoritäres Erbe, eine ungefestigte Parteienlandschaft, er leide unter dem Aderlass gen Westen und hege Frust über viele Verluste sowie gegenüber der Arroganz der Westdeutschen. Darüber hinaus fehle dem Osten die Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit, die Erfahrung mit Migration sowie die Sozialisierung in einer offenen Gesellschaft mit ihren „Zumutungen“. Er bezog sich auch auf die „Veränderungserschöpfung“ im Osten, die der Wissenschaftler Steffen Mau in seinem Buch „Ungleich vereint“ festgestellt hat.
Der Ausruf „Nie wieder Krieg“ (der seit Ende des Zweiten Weltkriegs als Mahnung gilt und heute in öffentlichen Debatten neu diskutiert wird – auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine) müsse, so Marko Martin, in einem ersten Schritt klären, ob ein Angriffskrieg oder Verteidigungskrieg gemeint sei.
Im Gespräch mit dem Publizisten und Juristen Prof. Dr. Michel Friedman bezog sich dieser während der Tagung auf eine weitere Variante des „Nie wieder“-Ausrufs: „Nie wieder ist jetzt“. Rein intellektuell betrachtet sei dieser Ausruf „eine Katastrophe“, so Friedman. „Nie wieder“-Ausrufe oder „Wehret den Anfängen“ sei in vielen Fällen zu einer ewigen Litanei und Sonntagspredigt verkommen. Er sagte: „Ich will kein schlechtes Gewissen, ich will Handlungen der Gegenwart.“ Er rief zur Selbstermächtigung des Vernunftsmenschen auf: Menschen in Deutschland sollten ihre Selbstblockaden und Denkblockaden überwinden und sich für die Gesellschaft engagieren, etwa als Bürgermeisterin oder Bürgermeister, in der Kommunalpolitik und ähnliches. „Meine Energie ist das Grundgesetz.“, so Friedman. Er könne nicht verstehen, wenn Menschen nicht aktiv dafür einstünden.
Darüber hinaus kritisierte Friedman die fehlende Auseinandersetzung in Deutschland mit der eigenen Vergangenheit im Dritten Reich. „Wie ist es denn dazu gekommen?“ sei die Frage, zu der er sich Aufarbeitung wünsche. In der Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands habe er den Streit vermisst – genauso wie die empathischen Brücken zueinander. „Bis heute machen wir uns nicht genug ehrlich über unsere eigene Geschichte“, so Friedman.
Geschichtliche und politische Einblicke anhand biografischer Erfahrungen boten die Beiträge des früheren Bundestagspräsidenten Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss, Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung, sowie in musikalisch-künstlerischer Form der Sänger und Musiker Sebastian Krumbiegel.
Ludwig Theodor Heuss, Arzt und Enkel des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, reflektierte in seiner Rede seine stark westlich geprägte Biografie und die familiären Erfahrungen, die seinen Blick auf Deutschland und die Geschichte des Landes geformt haben. Trotz seines Großvaters habe seine Sozialisation überwiegend außerhalb Deutschlands stattgefunden. Heuss berichtet, dass auch er durch Flucht-, Exil- und Verfolgungsgeschichten seiner Eltern geprägt wurde. Aus diesem persönlichen Zugang leitet er drei Themen ab, die für den „langen Weg seit Theodor Heuss“ zentral sind: Demokratisierung, Vergangenheitsbewältigung und Liberalismus.
Erstens schilderte er die schwierige Entstehung demokratischer Kultur nach 1945. Viele Deutsche hätten Demokratie nur formal übernommen, ohne sie als Lebensform zu verstehen. Theodor Heuss habe früh betont, dass Demokratie die Anerkennung des anderen als gleichwertigen Menschen voraussetzt. „Er konnte integrieren“, sagte Heuss über seinen Großvater. Debatten über Gleichberechtigung, gesellschaftliche Teilhabe und Konfliktkultur hätten die junge Bundesrepublik geprägt. Später radikalisierte sich die Diskussion, insbesondere seit 1968, wodurch das Verständnis von Demokratie zunehmend ideologisch überlagert wurde.
Zweitens beschrieb Heuss die Entwicklung der deutschen Erinnerungskultur. Sein Großvater habe mit seinen Reden entscheidende Impulse für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus gesetzt (1949 Begriff der „Kollektivscham“ in Gegenüberstellung zur „Kollektivschuld“, 1952 in Bergen Belsen: „Wir haben von den Dingen gewusst“). Dennoch sei die Auseinandersetzung lang und widersprüchlich verlaufen, mit Kontinuitäten ehemaliger NS-Eliten und erst später konsequenter juristischer Ahndung. Auch die Aufarbeitung der DDR-Diktatur nach 1989 sei unvollständig geblieben. Erinnerungspolitik sei in Deutschland bis heute politisch umkämpft.
Drittens thematisierte Heuss den Wandel des Liberalismus: von einem humanistisch geprägten Freiheitsverständnis seines Großvaters hin zu stärker marktwirtschaftlich dominierten Strömungen ab den 1980er-Jahren. Liberalität bedeute jedoch stets die Balance von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung.
Zu Ende seines Vortrags zeichnete Heuss ein ernüchterndes Bild der Gegenwart: eine Erosion demokratischer Zustimmung, ein Wiedererstarken autoritärer Tendenzen, wachsende Geschichtsvergessenheit und ein Bruch im politischen Grundkonsens – besonders sichtbar in Ostdeutschland. „Wir stehen vor dem Scheitern und dem Bankrott der politischen Bildungsarbeit der vergangenen Jahrzehnte!“, so Heuss. Er fragte auch: „Hat die deutsche Gesellschaft die Wiedervereinigung nicht verkraftet?“. Die Herausforderungen von 2025 ähnelten in ihrer Grundstruktur denen der Nachkriegszeit: Demokratie, Freiheit und Solidarität müssten erneut grundlegend definiert und verteidigt werden.
Dr. h.c. Wolfgang Thierse, früherer Bundestagspräsident, reflektierte in seiner Rede die 35 Jahre seit der deutschen Wiedervereinigung und erinnerte sich dabei an einen Text aus dem Jahr 1992, der im Spiegel erschienen war und den Titel „Zwei Welten oder eine?“ trug. Darin beschrieb der die gescheiterte Chance, die Einheit als gemeinsame, identitätsstiftende Leistung zu begreifen. Trotz der Hoffnungen auf Solidarität und Integration in den Westen, erlebten viele Ostdeutsche eine schmerzhafte Transformation, die bis heute nachwirkt. Besonders die politische Spaltung zwischen Ost und West bleibt auch nach Jahrzehnten sichtbar. Die deutsch-deutsche Geschichte habe vor 80 Jahren einen gemeinsamen Ausgangspunkt genommen – in einer gemeinsamen Erfahrung einer materiellen und moralischen Katastrophe. Durch die Siegermächte habe schließlich die Trennungserfahrung begonnen. „Wir Ostdeutschen hatten den Krieg mehr verloren“, so Thierse. Der Krieg sei im Osten länger „anwesend“ gewesen – allein schon durch das Erscheinungsbild der Städte und Gemeinden. Während der Westen Teil der westlichen Gemeinschaft wurde und Demokratie einüben konnte, sollten die Menschen im Osten helfen, die kommunistische Utopie zu verwirklichen.
Während der deutschen Teilung prägten völlig unterschiedliche Erfahrungswelten die Menschen auf beiden Seiten: Der Westen stand für eine Erfolgsgeschichte, für Wohlstand, Wachstum, stabile Demokratie und ein offenes Land. Dagegen sahen sich die Menschen in der DDR mit Enteignungen konfrontiert, mit Zwangskollektivierungen, Massenflucht und dem Gefühl des Eingesperrtseins. Die Wiedervereinigung begann schließlich mit einer großen Hoffnung auf der Seite der DDR-Bürger. Sie mündete dann allerdings in vielen Fällen in ein Gefühl der Demütigung und Zurücksetzung.
Die historischen und sozialen Unterschiede zwischen Ost und West prägten noch heute das politische und gesellschaftliche Leben beider Teile Deutschlands. Besonders im Osten fehle es an einer starken Zivilgesellschaft, was zu einer schwächeren Demokratie und einer Tendenz zu autoritären Einstellungen führt. Thierse stellte für den Osten eine andere Identifizierung zur eigenen Nationalität fest, das Empfinden der nationalen Zugehörigkeit sei hier höher – für viele Menschen sei das auch „Trost und Hoffnung“.
Thierse warnte vor den autoritären Versuchungen, die derzeit weltweit zunehmen. In Deutschland sei es entscheidend, die demokratischen Werte zu bewahren und nicht den populistischen, autoritären Kräften nachzugeben. Was beide Teile Deutschlands verbinde, seien die aktuellen Probleme wie etwa die härteren Verteilungskämpfe. „Die Bürger bedürfen der schmerzlichen Einsicht, dass Leben in Freiheit nicht identisch sein muss mit andauerndem Wirtschaftswachstum.“
Sebastian Krumbiegel, Musiker und Sänger der Gruppe „Die Prinzen“ setzte einen wort- und musikgewaltigen Akzent am Flügel des Musiksaals der Evangelischen Akademie Tutzing. Zunächst im Gespräch mit Akademiedirektor Udo Hahn und im Anschluss singend und musizierend nahm der das Publikum des Politischen Clubs mit auf eine Reise zu seinen weiblichen Vorbildern (neben Mutter und Großmutter auch „Kindergartentante Dagmar“). Dabei ging es auch um den Moment seiner eigenen Politisierung. Seine Großmutter habe ihn „politisch angeknipst“, als sie ihm vom 9. November 1938 erzählte – und von ihrer Scham darüber, sich damals weggeduckt zu haben.
Dr. Günther Beckstein, Bayerns früherer Ministerpräsident, ging in seiner Rede auf die historische, wirtschaftliche, kulturelle und politische Bedeutung Bayerns innerhalb Deutschlands ein. Er erinnert daran, dass Bayern frühzeitig den Föderalismus als zentrales Prinzip der deutschen Politik forderte, insbesondere während der Wiedervereinigung, als der Freistaat maßgeblich an der Gestaltung des föderalen Rahmens beteiligt war.
Als wichtigen Beitrag Bayerns in der Geschichte nach 1945 wertete Beckstein die Initiative von Franz Josef Strauß, im deutsch-deutschen Vertrag von Willy Brandt für eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit gekämpft zu haben – die schließlich Voraussetzung war, damit später Flüchtlinge aus der DDR Unterschlupf in westdeutschen Botschaften wie etwa in Prag finden konnten. Ursprünglich war der deutsch-deutsche Vertrag von einer eigenen DDR-Staatsangehörigkeit ausgegangen.
Beckstein erinnerte an die in der Verfassung verankerte Verpflichtung eines gesamtstaatlichen Denkens, für einigermaßen gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Aus diesem Grund besitze der Finanzausgleich der Länder im Grundsatz Verfassungsrang. Wie er im Einzelnen ausgestaltet werde, sei eine weitere Frage.
Abschließend betont der Beckstein die Notwendigkeit einer respektvollen und sachlichen politischen Auseinandersetzung, um Lösungen zu finden und die Demokratie zu stärken. „Die politischen Schwierigkeiten, die wir heute haben, sind größer, als wir sie jemals hatten.“, so Beckstein. Aus diesem Grund benötigten Politiker „mehr Unterstützung und weniger insbesondere bösartige Kritik. Denn wenn die Demokraten untereinander sich nur hart persönlich attackieren, dann ist es kein Wunder, wenn die Bürger auch kein Vertrauen haben.“
Die Philosophie der Demokratie bedeute Rede und Gegenrede, Argument und Gegenargument. Dadurch komme man der zweckmäßigeren Lösung am nächsten. Zur AfD sagte er: „Wir müssen die Auseinandersetzung suchen und die AfD inhaltlich stellen und nicht mit formalen Methoden.“ Darüber hinaus sieht er die Notwendigkeit „zu schauen, dass der Staat besser funktioniert: Abbau der Bürokratie, Aufarbeitung von Corona, Funktionsfähigkeit von Ausländer- und Asylpolitik, Frage der Verschuldung, all diese Themen müssen wir versuchen, funktionstüchtig zu machen.“ Er riet davon ab, ein AfD-Verbotsverfahren anzustreben. Zum einen, weil aus seiner Erfahrung zweier gescheiterter NPD-Verbotsverfahren, ihren Nebenwirkungen heraus und europarechtlichen Vorgaben – sowie aus der Tatsache heraus, dass die AfD die größte Oppositionspartei stellt.
Prof. Dr. Christina Morina trug per Video-Konferenz eine transatlantische Perspektive bei. Die Historikerin, die zum Zeitpunkt der Tagung bei einem Forschungsaufenthalt in den USA weilte, teilte Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb in den USA, in denen sie Versuche beobachtet, eine gewaltengeteilte Ordnung in eine autokratische Ordnung zu verwandeln und in der es infolgedessen zu offener Gewalt kommen könnte. Sie sprach von einer tief kulturellen Bewegung (MAGA), die andauern werde. Viele soziale Errungenschaften würden im Zuge der Bewegung perspektivisch abgeschafft. Politische Macht und Meinungsmacht werde mit Gangstermethoden und Bullying ausgeübt – sowohl nach innen als auch nach außen beobachte sie eine „aggressive imperiale Haltung“, die in vorauseilendem Gehorsam von Anhängern der MAGA-Bewegung angenommen werde.
Auch der kirchliche Aspekt und seine Rolle für die Gesellschaft kam in der Tagung zur Sprache. „Deutschland ist kein homogenes Land“ sagte Christian Kopp, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, in seinem Vortrag gleich zum Auftakt der Tagung. Kirche könne als Ort der Gemeinschaft und Sinnorientierung Menschen ein starkes Gefühl der Beheimatung bieten – wenn sie es gut macht. Kirche könne teilen, aber auch verbinden. „In einer Demokratie braucht es eine Religion, die sich am Gemeinsinn orientiert.“ Dabei verwies Kopp auf die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, sowohl in politischen als auch in kirchlichen Bereichen. Besonders im Osten habe die Kirche mit einem schwächeren Glaubensleben und geringerem Vertrauen zu kämpfen, während sie im Westen durch die Migration nach dem Zweiten Weltkrieg und eine stärkere Wirtschaftsentwicklung wuchs.
Kopp ging in seinem Vortrag auch auf die demografischen Herausforderungen ein, die zu einem kontinuierlichen Mitgliederschwund führen, und stellt fest, dass der Verlust von Kirchenmitgliedern nicht nur durch das Verhalten der Kirchenleitungen, sondern auch durch gesellschaftliche Trends wie Digitalisierung und Individualisierung bedingt ist. Dennoch erkennt er, dass die Kirche auch weiterhin eine bedeutende Rolle im Gemeinwohl und der Demokratie spielt, wenn sie als Ort der Inklusion und des respektvollen Dialogs fungiert. Kopp sprach von der Notwendigkeit, die Kirche als einen Ort der Begegnung zu gestalten, an dem Menschen sich verstanden und zugehörig fühlen.
Dorothea Grass
Hier geht es zur Bildergalerie der Tagung
Während der Tagung zitierte Bücher & Texte (unvollständige Liste):
- Heinrich August Winkler „Der lange Weg nach Westen“
- Franziska Augstein „Winston Churchill“
- Merle Goll, Friederike Ablang, Sabine Kranz „Das Friedenstier – Mit Stift und Flügeln für den Frieden“ (Kinderbuch)
- Orit Gidali, Tami Bezaleli, Lucia Engelbrecht „Der Erinnerungshändler“ (Kinderbuch)
- Leonard Cohen „Anthem“
- Raymond Aron „Plädoyer für das dekadente Europa“
- Steffen Mau „Ungleich vereint – Warum der Osten anders bleibt“
- Jackie Thomae „Brüder“ (Roman)
- Wolfgang Thierse „Zwei Welten oder eine?“ (Spiegel-Essay Juni 1992)
- Gustav Stolper „German Realities“
- Ines Geipel „Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück.“
- Sebastian Krumbiegel „Meine Stimme: Zwischen Haltung und Unterhaltung“
- Christina Morina „Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er-Jahren“
Foto: Haist / eat archiv