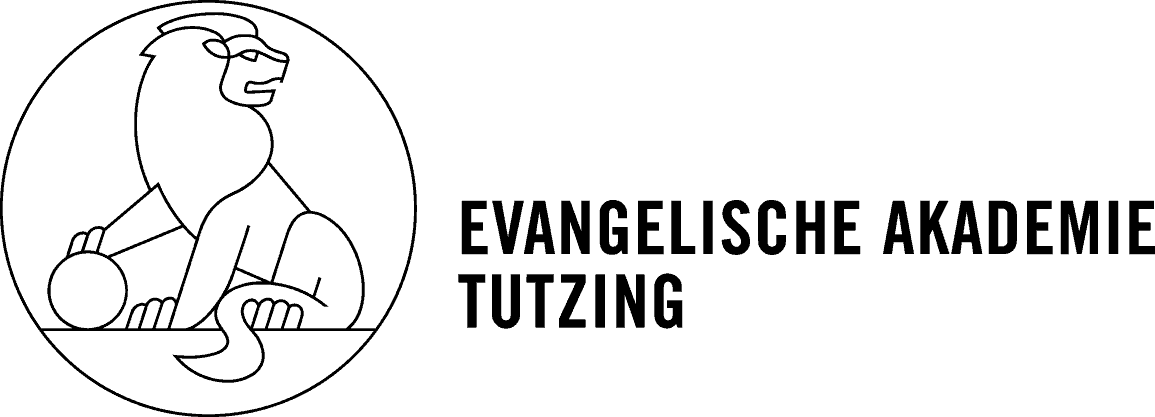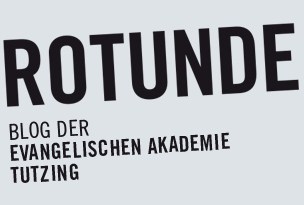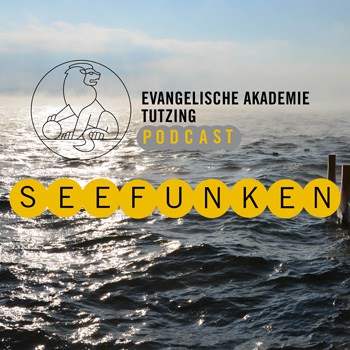Die Geschichten hinter den Dingen
Provenienzforschung ist detektivische Puzzlearbeit – und Teil eines größeren gesellschaftlichen Prozesses. Für Kerstin Holme ist sie “ein Auftrag zur kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte”. In diesem Gastbeitrag schreibt die Provenienzforscherin von Schloss Tutzing, warum ihre Disziplin selten eindeutige Ergebisse liefert und weshalb historische Kontexte eine entscheidende Rolle spielen.
Von Dr. Kerstin Holme
Sie stehen da. Ganz still. Hinter Glas, in Regalen, auf Podesten. Manchmal etwas schief aufgestellt, gelegentlich mit einem leicht vergilbten Zettel: “Unbekannter Künstler” oder “Herkunft unklar”. Wer in Museen, Bibliotheken, Archiven, im Kunsthandel oder in Sammlungsmagazinen arbeitet, begegnet ihnen täglich – Objekten mit Vergangenheit, aber ohne nachvollziehbare Herkunft. Mit undefinierbaren Stempeln, beschädigten Etiketten oder schlicht: ohne rechtlich saubere, lückenlos dokumentierte Provenienz. Und genau hier beginnt die Arbeit.
Provenienzforschung – das klingt zunächst spröde. Nach verstaubten Archiven, brüchigen Inventarbüchern, kryptischen Signaturen. Nach alten Schriften wie Kurrent oder Sütterlin, die kaum noch jemand lesen kann. Doch wer sich darauf einlässt, entdeckt ein faszinierendes Feld voller Spannungen, Umwege und Überraschungen. Zwischen Wissen und Nichtwissen. Zwischen Aufklärung und Verantwortung. Und auch zwischen dem, was sein sollte – und dem, was möglich ist.
Im Kern geht es bei Provenienzforschung um Verantwortung – gegenüber der Geschichte, aber vor allem gegenüber den Menschen, denen Unrecht widerfahren ist. Das gilt für alle historischen Kontexte, in denen Kulturgut unter Gewalt, Zwang, Enteignung, Ausgrenzung, Beschlagnahme oder Raub den Besitzer wechselte. Gerade bei NS-Raubgut wird deutlich, wie sehr Provenienzforschung über eine rein wissenschaftliche Tätigkeit hinaus auch eine ethische Verpflichtung ist – eine Haltung, wie sie bereits die Washingtoner Prinzipien von 1998 eingefordert haben.
Provenienzforschung – längst mehr als eine Fachdomäne
In der Provenienzforschung zu NS-Raubgut richtet sich der Fokus darauf, Kulturgut zu identifizieren, das zwischen 1933 und 1945 verfolgungsbedingt entzogen wurde – ein Begriff, der neben offenem Raub auch Zwangsverkäufe, beschlagnahmtes Fluchtgut oder Enteignungen im Zuge systematischer Verfolgung umfasst. Der Blick gilt dabei den Menschen, die unter der NS-Diktatur entrechtet und verfolgt wurden – insbesondere jüdischen Familien, aber auch anderen Betroffenen, denen aus politischen, rassistischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen schweres Unrecht widerfuhr, sowie ihren Nachfahren, Erbinnen und Erben. Zahlreiche Angehörige leben heute noch mit offenen Fragen, schmerzlichen Verlusten und ungeklärten Besitzverhältnissen; viele konnten nie Antworten erhalten. Provenienzforschung kann das Geschehene nicht ungeschehen machen – sie kann jedoch dazu beitragen, Unrecht zu benennen, Erinnerung zu ermöglichen und, wo möglich, NS-Raubgut zu identifizieren und gerechte und faire Lösungen gemeinsam mit den Eigentümer:innen oder ihren Erbinnen und Erben zu finden.
Denn Provenienzforschung ist längst keine exklusive Domäne von Fachhistoriker:innen mehr. Sie ist Teil eines größeren gesellschaftlichen Prozesses: ein Auftrag zur kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte – und mit den Geschichten hinter den Dingen.
Ein Missverständnis hält sich hartnäckig: dass Provenienzforschung eindeutige Zuschreibungen liefert – “unbelastet”, “belastet”, “unklar” –, die man einem Objekt wie ein Gütesiegel anheften könnte. Doch so einfach ist es nicht. Zwar arbeiten viele Einrichtungen – auch wir im Projekt der Evangelischen Akademie Tutzing – mit dem vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste empfohlenen Ampelsystem: Rot steht für NS-verfolgungsbedingt entzogen, Grün für unbedenklich. Doch gerade die Zwischenstufen – Gelb (offene Fragen, Provenienzlücken) und Orange (problematische Erwerbsumstände) – sind weniger eindeutig. Ihre Bewertung variiert je nach institutionellem Kontext, Stand der Überlieferung, Forschungsfortschritt und der Tiefe, mit der recherchiert werden kann. Provenienzforschung liefert selten eindeutige Antworten – sie ist kein Stempel, sondern ein Prozess: ein fortlaufender, dynamischer Erkenntnisweg, der mit jeder neuen Quelle neue Fragen aufwirft.
Dabei geht es häufig um das, was fehlt: das Etikett, das abgerissen wurde; der Eintrag, der gelöscht oder unlesbar ist; die Übergabe, die nie dokumentiert wurde; die Namen, die nicht mehr auffindbar sind. Und selbst wenn Unterlagen existieren, müssen sie kritisch geprüft werden: auf Herkunft, Echtheit und Kontext. Leerstellen sind kein Scheitern, sondern Teil des Forschungsgegenstands.
Verantwortung übernehmen, aus einer Haltung heraus
Wer Provenienzforschung betreibt, arbeitet nicht nur mit Inventarbüchern und Archivalien, sondern mit vielen Puzzleteilen: Objektmerkmale wie Etiketten, Stempel oder Rückseitenaufschriften, alte Fotografien, Korrespondenzen oder Auktionskataloge, um nur einen Teil zu nennen. Kenntnisse in Quellenkunde, Archivarbeit und historischer Kontextualisierung sind dafür ebenso notwendig wie die genaue Untersuchung der Objekte selbst. Nur so lässt sich die Besitzgeschichte eines Kulturguts zumindest annähernd rekonstruieren – die zentrale Grundlage jeder Provenienzbewertung.
Seit der Washingtoner Erklärung sind öffentliche Einrichtungen in Deutschland aufgefordert, ihre Sammlungen systematisch auf NS-verfolgungsbedingten Entzug zu prüfen. Für private Träger wie Stiftungen, kirchliche Einrichtungen, privat finanzierte Museen oder Privatpersonen gilt das bislang nicht gesetzlich. Doch gerade dort, wo sich Institutionen als Bildungsorte verstehen, wächst das Bewusstsein, dass auch sie öffentliche Verantwortung tragen – nicht aus Verpflichtung, sondern aus Haltung.
Provenienzforschung ist aufwendig: Sie braucht Zeit, Expertise und Geld. Seit 2008 fördern Bund und Länder entsprechende Projekte zur Aufarbeitung von NS-Raubgut. Um diese Arbeit strukturell zu stärken, gründeten Bund, Länder und Kommunen 2015 das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Es hat seither über 400 Projekte unterstützt – darunter auch das der Evangelischen Akademie Tutzing. Seit über zwei Jahren erforschen wir im Rahmen dieser Förderung die Herkunft unserer Sammlungsobjekte – mit einem besonderen Fokus auf mögliche Fälle von NS-Raubgut. Dabei stehen nicht nur die Objekte selbst im Zentrum, sondern auch die historischen Kontexte, in denen sie sich bewegt haben – darunter die Besitzgeschichte von Schloss Tutzing. Denn auch sie beeinflusst, wie wir jedes einzelne Objekt heute betrachten und bewerten.
Ein kontinuierlicher Reflexionsprozess
Wer etwas über die Herkunft eines Gemäldes, einer Büste oder einer Grafik erfahren will, muss auch fragen: In welchem gesellschaftlichen oder politischen Umfeld wurde gesammelt? Unter welchen Bedingungen? Wer war verantwortlich, wer hat Entscheidungen getroffen? Die Geschichte einer Sammlung ist immer auch die Geschichte des jeweiligen Ortes – mitsamt seinen Haltungen, Verstrickungen und Leerstellen. Auch das gehört zur Provenienzforschung.
Denn Provenienzforschung endet für uns nicht mit einem Bericht – sie ist kein Schlussstrich, sondern ein kontinuierlicher Reflexionsprozess. Ein Objekt ohne Kontext bleibt ein Fragment. Ein Bild ist nicht nur ein Bild – es ist auch ein Besitzverhältnis, eine Geschichte, eine Erinnerung. Herkunft zu erforschen heißt nicht, Vergangenes festzuschreiben, sondern es zu beleuchten – und für neue Fragen, Perspektiven und Bewertungen offen zu halten.
In einer Zeit, in der globale Sammlungen zunehmend hinterfragt werden – Stichworte: koloniale Kontexte, indigene Perspektiven, außereuropäische Kunst – wächst das Bewusstsein, dass Provenienzforschung keine reine Korrekturmaßnahme ist. Sie ist Teil einer aktiven Erinnerungskultur – und mitunter ein Schritt hin zu mehr Verständigung.
Dass sie nicht immer einfache Antworten liefert, macht sie nicht weniger wichtig. Im Gegenteil: Gerade die Vielschichtigkeit und die Offenheit für neue Perspektiven machen ihren Wert aus. Wer Provenienzforschung ernst nimmt, setzt sich mit den Geschichten hinter den Dingen auseinander. Und manchmal – wenn Wissen, Kontext und Verantwortung sich verbinden – lässt sich so auch ein kleiner Beitrag zu mehr Gerechtigkeit leisten.
Über die Autorin
Dr. Kerstin Holme leitet das Provenienzforschungsprojekt “Schloss Tutzing”, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird. Mehr dazu unter https://kulturgutverluste.de/
Weitere Artikel zum Projekt:
- “Provenienzforschung im Schloss Tutzing: eine ‘Mammutaufgabe'”, Interview mit Kerstin Holme (April 2023) hier lesen
- Pressemitteilung zur Anschlussförderung (Dezember 2023) hier lesen
- “Auf Raubkunstjagd im Schloss”, Artikel von Katja Sebald in der Süddeutschen Zeitung (März 2024) hier lesen
- “Auf der Spur der NS-Raubkunst: Schloss Tutzing unter der Lupe”, Artikel von Peter Schiebel im Starnberger Merkur (Mai 2025) hier lesen
- “Forschen nach Leichen im eigenen Keller”, Artikel zum SZ-Kultursalon (Oktober 2024) von Sabine Reithmaier hier lesen
Bild: Dr. Kerstin Holme (Foto: Haist / eat archiv)