Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen.
William Faulkner
„Hatten Sie schon einmal den Gedanken, dass mit der eigenen Familiengeschichte etwas nicht stimmt beziehungsweise dass etwas fehlt? Kennen Sie dieses vage Gefühl, dass es ein Geheimnis – einen blinden Fleck – in der Familie gibt?“ Diese Fragen waren für den Trauma- und Stressexperten Louis Lewitan, Sohn von Schoah-Überlebenden, und den Journalisten Stephan Lebert der Anlass für eine umfassende Recherche. Dass sie den Giftschrank der deutschen Erinnerung öffnen würden, war ihnen nicht gleich bewusst. Umso größer ihr Erschrecken: Ihre rund einhundert Interviews haben gezeigt, dass die Erzählungen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, oft nur ein unvollständiges Bild vermitteln. Vieles bleibt unerwähnt, Verbrechen werden verschwiegen, moralisch Verwerfliches wird verdrängt, die Mitverantwortung an Verbrechen wird verharmlost, die eigene Rolle kleingeredet. So wundert es nicht, wenn achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs achtzig Prozent der Deutschen glauben, ihre Vorfahren seien im Widerstand gegen die Diktatur des Nationalsozialismus aktiv gewesen oder hätten sich zumindest nichts zuschulden kommen lassen.
Lewitan und Lebert wollten es genauer wissen und fragten für ihr Buch „Der Blinde Fleck. Die vererbten Traumata des Krieges – und warum das Schweigen in den Familien jetzt aufbricht“ Nachgeborene, was sie von ihren Familien über die Jahre 1933 bis 1945 wissen. Die Ereignisse liegen weit zurück und es leben nur noch wenige Zeitzeugen. Ihre Vergangenheit jedoch hinterlässt bis heute Spuren in den Familien. Geprägt durch eine Katastrophe, die sie nicht selbst erlebt haben, tragen viele Nachkommen im Land der Täter und Mitläufer seelische Narben, deren Ursachen sie oft nur vage kennen. Oft sind bleiernes Schweigen, verdrängte Erinnerungen, wohlgehütete Geheimnisse und hartnäckige Lügen allgegenwärtig – ein erdrückendes Erbe.
„Man kann seine Vergangenheit nicht vergessen. Und wenn man es versucht, findet sie meistens Wege, auf sich aufmerksam zu machen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte hat zeitlose Relevanz. Denn am Ende bedient sie doch ein universelles Bedürfnis: Eigentlich wollen wir alle doch einfach nur verstehen, warum wir zu denen wurden, die wir sind“, schreibt Joëlle Lewitan in dem Buch. Zusammen mit ihrem Vater – Louis Lewitan – ist sie zu Gast in der Evangelischen Akademie Tutzing.
Wir laden Sie herzlich zur Lesung und zum Gespräch in die Evangelischen Akademie Tutzing ein.
Pfr. Udo Hahn
Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing


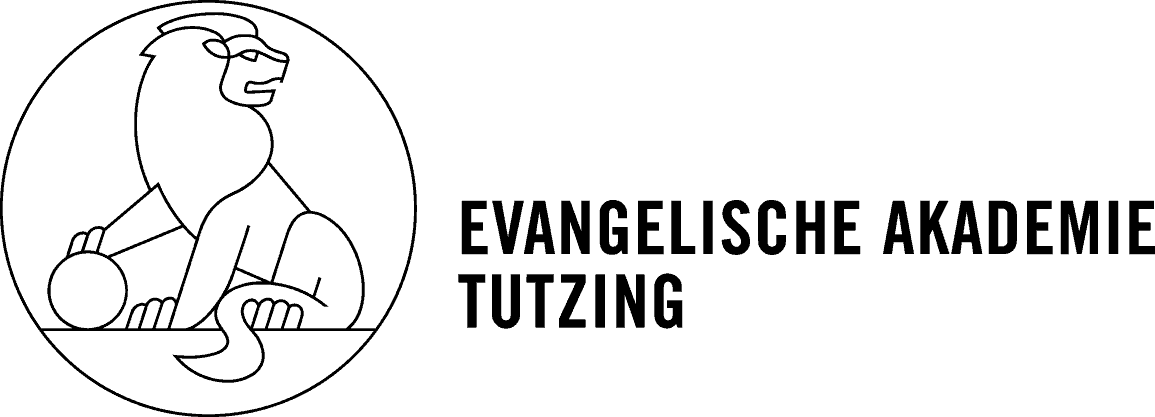



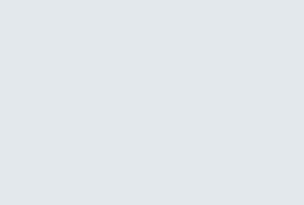


 SoraOpenAI_Haase.png)

