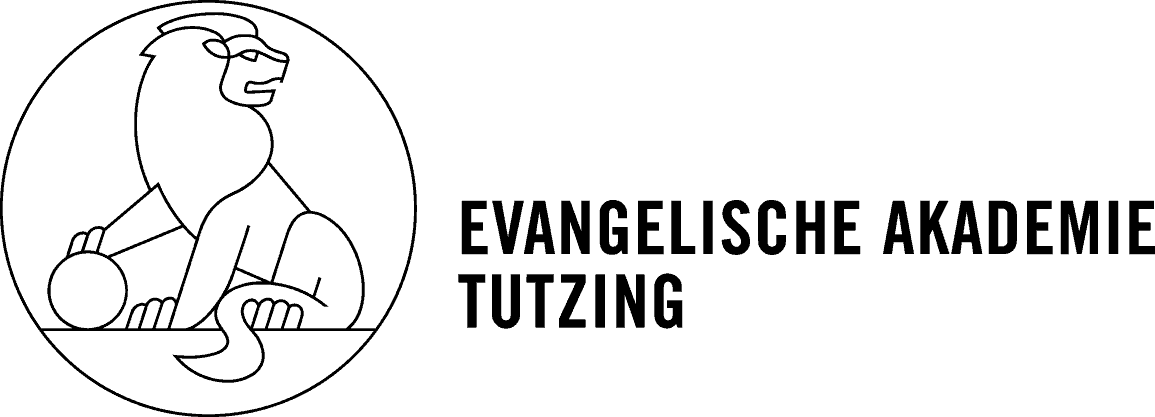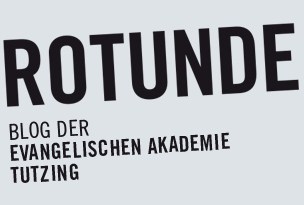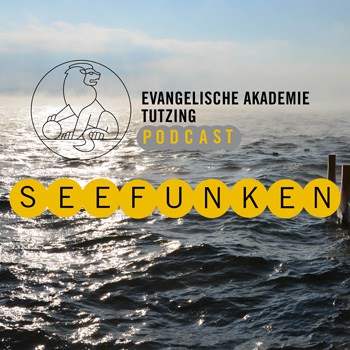Politik zum Anfassen und Verstehen
In der Politikwerkstatt im Oktober drehte sich dieses Mal alles um China, die USA, finanzielle Inklusion, Populismus und Wirtschaftswachstum. Im UN-Planspiel wurde es interaktiv, in der Debatte mit Landtagsabgeordneten diskursiv. Rückblick auf ein lebendiges Tagungswochenende des Jungen Forums.
Trumps “MAGA”-Rhetorik (Make Amerika Great Again), Chinas Null-Covid-Politik und die Frage nach nachhaltigem Wirtschaftswachstum – selten waren globale Zusammenhänge so präsent im Alltag junger Menschen wie heute. Während wir täglich mit Nachrichten aus aller Welt überflutet werden, fällt es oft schwer, die wesentlichen politischen Linien zu erkennen. Wie hängen amerikanische Innenpolitik, chinesische Gesellschaftspolitik und deutsche Klimaschutzdebatten zusammen? Und vor allem: Welche Rolle kann die nächste, also die junge Generation in dieser vernetzten Welt spielen?
Die Politikwerkstatt vom 10. bis 12. Oktober 2025 in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (zum Programm) widmete sich genau diesen Verflechtungen. Statt einzelne Länder isoliert zu betrachten, ging es darum, die Dynamiken zwischen verschiedenen politischen Systemen zu verstehen und eigene Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. In der Begrüßung betonte das Leitungsteam, in der Tagung konkrete Einblicke in aktuelle Weltpolitik geben zu wollen statt sich mit abstrakten Theorien zu beschäftigen. Die 85 Tagungsgäste waren zwischen 16 und 27 Jahre alt und kamen von verschiedenen Schulen und Schularten bzw. Hochschulen und Universitäten. Auch Young Professionals waren dabei.
Wann wird Populismus problematisch?
Julian Müller-Kaler, Experte für strategische Vorausschau am Stimson Center, eröffnete die Tagung virtuell von Washington D.C. aus. Bekannt unter anderem aus der Tagesschau, schaltete er sich nach Tutzing zu. Als assoziiertes Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bedeutet US-amerikanische Politik für Müller-Kaler nicht nur Wahlergebnisse oder Umfragewerte, sondern auch den Zusammenhang als gesellschaftliches Phänomen zu sehen. Strategische Vorausschau heiße nicht, so Müller-Kaler, die Zukunft vorherzusagen, sondern sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten und somit Resilienz zu bilden. Besonders faszinierend war seine Analyse des Populismus: Wenn man Populismus als Komplexitätsreduktion versteht, handle im Grunde jede:r Politiker:in populistisch. Denn in der Kommunikation werden schwierige Sachverhalte oft auf vereinfachte Botschaften heruntergebrochen. Das Problem entstehe erst, wenn diese notwendige Vereinfachung zur Oberflächlichkeit wird.
Auch um die wirtschaftliche Situation in den USA ging es. “Es ist inzwischen eine große Herausforderung, zukünftig finanziell besser als die eigenen Eltern aufgestellt zu sein”, brachte Müller-Kaler die wirtschaftlichen Sorgen vermutlich vieler US-Amerikaner:innen auf den Punkt. Trump repräsentiere deshalb weniger eine politische Bewegung als eine Form der gesellschaftlichen Frustration über die letzten Jahrzehnte. Er sei vielmehr Symptom als Ursache der gesellschaftlichen Eskalationsprozesse in den Vereinigten Staaten.
Erfahrungsberichte aus China und den USA
Nach den USA führte China am Samstagmorgen die weltpolitische Linie der Tagung fort. Lea Sahay stellte China nicht als abstrakte Weltmacht dar, sondern vermittelte einen persönlich geprägten Eindruck als deutsche Journalistin, die in China lebt. Die China- Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung war bereits als 16-Jährige für ein Austauschjahr nach China gegangen. In dieser Zeit bereitete sich das Land China auf die Olympischen Spiele 2008 vor. Sahays Berichte von der Gastfamilie, deren Mitglieder monatelang für Nike-Schuhe sparten und diese dann nur sonntags zum Restaurantbesuch trugen, illustrierten Chinas rasanten gesellschaftlichen Wandel. 2008 war Nike noch ein Luxusgut. Heute ist China selbst zur globalen Wirtschaftsmacht aufgestiegen.
Sahay schilderte auch die Kehrseite dieser Entwicklung. Sie berichtete von ihren persönlichen Erfahrungen mit Chinas Politik während der Corona-Pandemie. In dieser Zeit wurde ihr schwerkrankes Kind wegen eines ausstehenden Covid-Tests in Chinas Krankenhäusern zunächst nicht behandelt. Das Erlebnis, das für viele andere individuelle Erlebnisse steht, verdeutlichte, wie staatliche Vorgaben in China durchgesetzt wurden. “Wenn du der Kommunistischen Partei im Weg stehst, dann wirst du zerquetscht”, fasste sie die Realität für ihre Branche der chinesischen Journalist:innen zusammen, die, wie sie, in China arbeiten. Vor allem bei den “roten Linien” Taiwan und Tibet kann es auch für Journalist:innen unangenehm werden. Sahays Fazit war differenziert: China sei weder die große Bedrohung noch das perfekte Vorbild, sondern ein Land mit eigenen komplexen Herausforderungen, von Jugendarbeitslosigkeit bis zur Überalterung in ländlichen Regionen.
Finanzielle Inklusion – wie geht das?
Ein Markenzeichen der Politikwerkstatt der Evangelischen Akademie Tutzing sind schnelle Themenwechsel, um an einem Tagungswochenende einen Überblick über verschiedene Bereiche und politische Ebenen zu geben. So fokussierte die Tagung nach China auf das Thema der finanziellen Inklusion. Wie ihre Vorrednerin Lea Sahay skizzierte Rim Melake das Thema im weltweiten Kontext. Melake arbeitet als Beraterin bei der Weltbank und ist einem breiten Publikum als Host des Podcasts “Para für alle” bekannt. Sie zeigte auf, dass die Digitalisierung weltweit nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist. 280 Millionen Frauen haben keinen Internetzugang. Sehr viele besitzen ein Handy, mit dem man telefonieren und SMS schreiben kann, jedoch handelt es sich dabei nicht um Smartphones. Um Bankgeschäfte erledigen zu können und damit finanziell unabhängig von der Familie zu sein, ist ein Internetzugang essenziell. Für viele Jugendliche in Deutschland, die täglich auf Instagram- und TikTok unterwegs sind, ist da nur schwer vorstellbar.
Die Gründe für fehlende Zugänge zum Netz sind vielfältig: Oft fehlt schlicht die Infrastruktur. In anderen Fällen kostet das Datenvolumen mehr, als sich Menschen mit zwei Dollar Tageslohn leisten können. Hinzu kommen kulturelle Barrieren. So wird Frauen in manchen Gesellschaften der Internetzugang verwehrt, um die Kontrolle über die Kommunikation oder das Agieren im Netz zu haben. Melakes Lösungsansatz ist pragmatisch: Zum einen muss die digitale Infrastruktur verbessert werden. Zum anderen liegt ein wichtiger Fokus darauf, mit lokalen Autoritätspersonen zusammenzuarbeiten, die in ihren Gemeinden für mehr digitale Teilhabe werben können. – Ein Beispiel dafür, dass Entwicklungspolitik oft bei sozialen Normen ansetzen muss, bevor technische Maßnahmen überhaupt wirken können.
Highlight der Tagung war für viele Tagungsgäste das Planspiel zu den United Nations (UN) mit dem Namen “Winds of Change”. Maximilian Nominacher von der Landeszentrale hatte es maßgeblich mit entwickelt und leitete das digitalbasierte Spiel an. Jeder Tagungsgast spielte eine Persona, wie zum Beispiel den brasilianischen Außenminister Mauro Vieira, den US-Präsidenten Trump oder den deutschen Bundeskanzler Merz. Somit agierte jede:r in seiner politischen und länderspezifischen Rolle im international simulierten Planspiel. Was zunächst wie ein Computerspiel wirkte, entpuppte sich schnell als knallharte Lektion in Realpolitik. So versuchte zum Beispiel das Spielteam in der Rolle Polens, verbesserte Bildung und Wirtschaftswachstum zu vereinbaren. Gleichzeitig kurbelte im Spiel aber das Team China mit Maßnahmen auf Kosten der Umwelt die Industrie an. Die digitale Plattform des Spiels zeigte in Echtzeit, wie sich jede Entscheidung auf andere Länder auswirkte. Gerade die Vorgabe, die Rollen realistisch und nicht utopisch oder gar bewusst optimistisch zu spielen, gaben viele Tagungsgäste in der Evaluation als herausfordernd an. Das Planspiel war damit ein Realitätscheck für alle, die glauben, Politik sei einfach.
“Du meckerst die Welt nicht besser”
Der im Publikum vielleicht kontroverseste Diskurs war am Samstagabend geboten: Brauchen wir endloses Wirtschaftswachstum? Dr. Katharina Bohnenberger (Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur Wien) skizzierte eine Debatte, die weit über übliche Klima-Diskussionen hinausging. Die Ausgangslage ist paradox: Städte wie San Francisco oder Mumbai leiden unter Extremwetterereignissen. Gleichzeitig profitiert wiederum nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung wirklich vom globalen Wirtschaftswachstum. Die einfache Antwort “China ist schuld” treffe nicht zu, so Dr. Bohnenberger. Das Problem sei systemischer Natur. Das oft genannte Zauberwort heißt “Entkopplung”. Das beinhalte die Hoffnung, dass Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch voneinander getrennt werden können. Doch basierend auf dem wissenschaftlichen Sachstand zeigte sich Dr. Bohnenberger skeptisch: Diese Entkopplung müsse nicht nur temporär, sondern permanent und hinreichend stark funktionieren. Dafür gibt es aktuell keine überzeugenden empirischen Belege. Das Gegenmodell klang fast philosophisch: eine Wirtschaft des “Genug”. “Die Idee von Genug ist, dass alle genug haben, nicht zu viel und nicht zu wenig”, fasste Dr. Bohnenberger ihre Vision zusammen. Ein ungewohnter Gedanke in der aktuellen Wachstumsgesellschaft.
Der Sonntagmorgen führte in der Debatte von der großen Weltpolitik zurück nach Bayern. Doch auch die Themen des Landtags wurden im weltweiten Bezug diskutiert. Der Diskurs fand mit drei Mitgliedern des Bayerischen Landtags statt: Anna Rasehorn, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Benjamin Adjei, Sprecher für Digitales und Europa der Grünen Fraktion Bayern und Josef Heisl, unter anderem im Ausschuss Arbeit und Soziales, Jugend und Familie für die CSU. Alle zeigten in persönlichen Geschichten auf, wie sie ursprünglich in die Politik kamen. Rasehorn berichtete von Naziaufmärschen in Augsburg, die sie als Jugendliche politisiert hatten. Zusätzlich sei da aber auch ein ganz praktisches Erfolgserlebnis gewesen: ein neuer Basketballplatz in ihrem Jugendzentrum, den sie auf Kommunalebene mit umsetzte. Heisl berichtete von einem ähnlichen kommunalpolitischen Initialereignis, bei dem es um einen Beachvolleyballplatz ging. Seine Erkenntnis damals: Auch junge Menschen können etwas bewegen, wenn sie sich organisieren. Adjei hatte früh gegen Schulgeld protestiert und war bei Anti-Atomkraft-Demos dabei. “Du meckerst die Welt einfach nicht besser, sondern du machst sie besser”, brachte er seine Grundhaltung auf den Punkt.
Wege in die Politik
Nach den persönlichen Geschichten über die verschiedenen Wege in die Politik wurden bei den konkreten Sachthemen die Unterschiede zwischen den Parteien deutlich. Zum Bildungssystem hatten Grüne und SPD eine klare Position: mehr gemeinsames Lernen, weniger frühe Selektion. Heisl verteidigte dagegen das dreigliedrige System. Er bezog sich dabei auf seine eigene Erfahrung als ehemaliger Mittelschüler, der nun in der Politik ist. Auch das Thema Künstliche Intelligenz war kontrovers auf dem Podium: Alle drei Politiker:innen gaben an, selbst KI zu nutzen, ob zur Terminplanung oder Textvorbereitung. Adjei warnte aber vor der Nutzung von KI bei politischen Themen. Die Qualität sei oft mangelhaft. Rasehorn sprach von “unglaublichem Bürokratie-Aufwand bei Startups”. Heisl sah sowohl Chancen als auch Risiken in der Technologie. Parteiübergreifend waren sich die drei Politiker:innen aber in diesem Punkt einig : Politisches Engagement ist wichtiger denn je. In einer Zeit, in der Demokratie weltweit unter Druck stehe, komme es auf jede und jeden einzelnen an.
Was bleibt nach drei Tagen intensiver Diskussionen? Zunächst die Erkenntnis, dass die Welt tatsächlich so komplex ist, wie sie in den Nachrichten wirkt. Es gibt keine einfachen Lösungen für Trumps Populismus, Chinas Aufstieg oder die Klimakrise. Aber es gibt Menschen, die mit oder an diesen Problemen arbeiten, von der Journalistin in Peking bis zum Landtagsabgeordneten in München. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis: Politik passiert nicht irgendwo da draußen, sondern überall dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen. Das kann bei einem UN-Planspiel in Tutzing sein, bei einem lokalen Basketballplatz-Projekt oder bei der Entscheidung, welche sozialen Medien man nutzt. Die Frage ist nicht mehr, ob die junge Generation politisch aktiv werden will. Die Frage ist nur noch: wo und wie?
Autor:innen: Mykola Podluzhnyi und Julia Wunderlich
Weiterlesen:
Das Sonntagsblatt-Interview mit Studienleiterin Julia Wunderlich zur Politikwerkstatt finden Sie hier.
Bild: Während des UN-Planspiels in der Rotunde der Akademie (Foto: eat archiv)