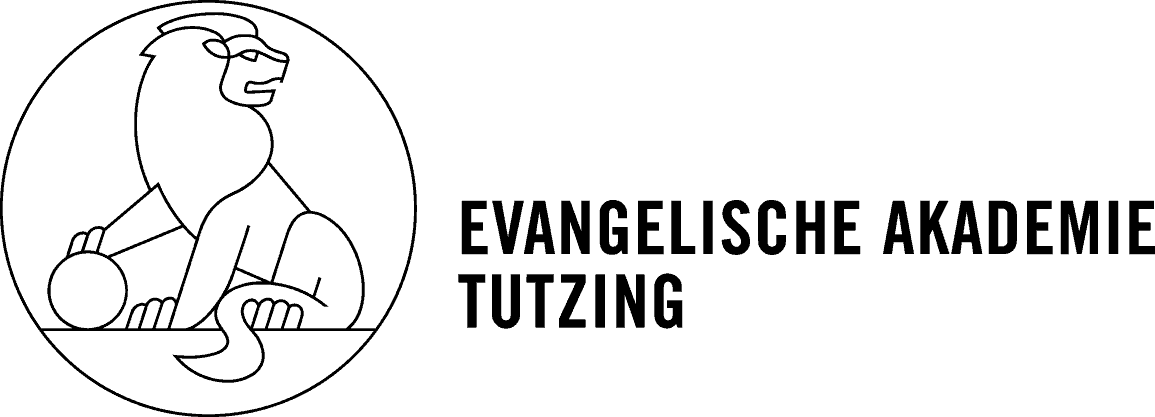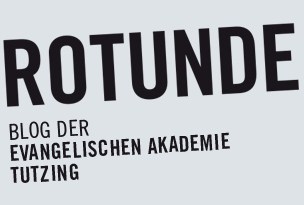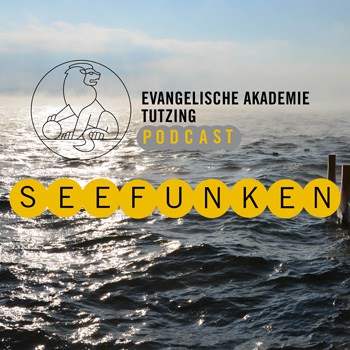“Einsamkeit ist ein gesellschaftliches, aber auch politisches Thema”
Einsamkeit ist längst kein Phänomen nur älterer Menschen mehr. Wie kann man dem begegnen – individuell, gesellschaftlich und kirchlich? Ein Gespräch mit Hendrik Meyer-Magister zeigt Ansätze und Herausforderungen auf.
Einsamkeit betrifft alle Altersgruppen und hat weitreichende Folgen für Gesundheit und Zusammenhalt. Expert:innen diskutierten bei der Tagung “Die vielen Einsamkeiten” vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 in der Evangelischen Akademie Tutzing, wie Prävention, Begegnungsräume und digitale Angebote helfen können – und welche Rolle Kirche und Diakonie spielen.
Das Sonntagsblatt sprach im Vorfeld mit dem Stellvertretender Akademiedirektor Dr. Hendrik Meyer-Magister, Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care, der die Tagung leitete.
Herr Meyer-Magister, wie nähert man sich dem Thema Einsamkeit am besten? Ist das ein Phänomen unserer Zeit?
Hendrik Meyer-Magister: Tatsächlich ist die Forschung hier nicht einheitlich. Manche sprechen von einer “Einsamkeitspandemie” – vor allem seit Covid-19. Zahlen des sozio-ökonomischen Panels zeigen, dass der Anteil von Erwachsenen in Bayern, die sich als “manchmal” einsam bezeichnen, von rund einem Drittel 2017 auf knapp 70 Prozent 2021 gestiegen ist. Ähnliches gilt für häufige Einsamkeit: Hier stieg der Anteil von 2,3 auf 16,2 Prozent. Vor der Pandemie galten vor allem ältere Menschen als betroffen – heute sind auch unter 30-Jährige stark betroffen.
Die Umfragen bestätigen also: Viele Menschen fühlen sich einsamer, gerade durch die Pandemie. Andere Forschungen argumentieren jedoch: Unsere modernen Gesellschaften werden nicht zwangsläufig einsamer. Die Möglichkeiten, uns zu vernetzen, sind so groß wie nie – also zwingt uns die Zeit nicht automatisch zur Einsamkeit.
Einsamkeit ist also subjektiv?
Genau. Die gängigste Definition beschreibt Einsamkeit als negatives, subjektives Gefühl: Ich empfinde meine sozialen Beziehungen als unzureichend – quantitativ oder qualitativ. Manche brauchen nur wenige enge Kontakte, andere ein großes Netzwerk. Lebensumstände wie Armut, alleinerziehend zu sein, Pflegeaufgaben, psychische Erkrankungen oder Verlust naher Angehöriger erhöhen das Risiko. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle: Während der Pandemie waren Frauen häufiger betroffen. Einsamkeit hängt also von persönlichen und sozialen Faktoren ab, ist aber zunächst ein subjektives Empfinden.
Und wie kann man dem begegnen?
Es geht nicht nur um den gut gemeinten Rat “Geh raus, such Kontakte”. Viele Betroffene sind sozial isoliert oder gesundheitlich eingeschränkt und finden aus eigener Kraft nicht mehr aus der Einsamkeit heraus. Deshalb ist es wichtig, soziale Risikofaktoren zu erkennen und gesellschaftlich gegenzusteuern: Armutsbekämpfung, Nachbarschaftstreffs, Begegnungsorte, Bibliotheken oder Cafés. Auch Kirche und Diakonie bieten Räume für Begegnung und können gezielt auf Menschen zugehen.
Einsamkeit hat also auch gesundheitliche Folgen?
Ja. Wer chronisch einsam ist, hat ein höheres Risiko für Depression, Antriebslosigkeit, sogar körperliche Erkrankungen wie Diabetes oder Demenz. Deshalb brauchen Menschen, die stark einsam sind, oft spezifische Ansprache – nicht nur allgemeine Einladungen, sondern etwa Sozialarbeit oder Begleitung in Kirchengemeinden.
Wird das nicht schwieriger, wenn die Mitgliederzahlen in Gemeinden sinken?
Ja, der Zugang zu Menschen wird schwieriger. Früher kannte die Pfarrerin fast jeden im Ort, heute sind viele Betroffene kaum noch in der Gemeinde sichtbar. Das ist eine Herausforderung, kann aber auch eine präventive Aufgabe sein, etwa bei Trauerbegleitung von Angehörigen bei Beerdigungen.
Kann Einsamkeit oder Alleinsein auch eine andere, spirituelle Dimension haben?
Einsamkeit nicht, aber Alleinsein. Das darf nicht verwechselt werden. In der kirchlichen Tradition – etwa im monastischen oder kontemplativen Leben – kann das bewusste Alleinsein sogar positiv sein: es dient der spirituellen Reflexion, Konzentration und inneren Entwicklung. Man kann also das Alleinsein, ohne Partner oder in einer abgeschiedenen Lebensform, als bewusst und erfüllend erleben. Umgekehrt kann man sich auch unter Menschen einsam fühlen – das ist eben ein subjektives Gefühl.
Was kann jeder selbst gegen Einsamkeit tun?
Für Betroffene steht etwa die Telefonseelsorge jederzeit und anonym zur Verfügung. Kleine Schritte helfen: Nachbarn, Freunde oder Familie aktiv ansprechen. Telefonate, Besuche, persönliche Nachrichten. Selbst kleine Gesten, wie ein gemeinsamer Kaffee oder ein Anruf, können viel bewirken. Sich gegen Einsamkeit zu engagieren stärkt nicht nur Einzelne, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und damit das Vertrauen in Gesellschaft und Demokratie. Denn Menschen, die sich einsam fühlen, verlieren oft das Vertrauen in Institutionen und werden anfälliger für populistische Narrative, Verschwörungstheorien und radikale Parteien.
Und digitale Vernetzung – hilft sie gegen Einsamkeit?
Das ist ambivalent. Sie kann, wie wir in Zeiten von Social Distancing während Covid-19 gesehen haben, durchaus positive Kontakte ermöglichen, ersetzt aber oft nicht die Qualität enger, verlässlicher Beziehungen. Manche Menschen fühlen sich trotz digitaler Vernetzung einsam. Projekte wie “Digital Streetwork” des Bayerischen Jugendring greifen das auf: Die “Streetworker” sprechen online gezielt Betroffene an und bieten Gesprächsangebote.
Die Tagung “Die vielen Einsamkeiten” in Tutzing Ende Oktober widmet sich dem Thema auf verschiedenen Ebenen. Was erwarten Sie davon?
Die Tagung soll ein Schritt auf einem langen Weg sein. Es geht um Vernetzung von Kirche, Diakonie, Zivilgesellschaft und Politik – etwa im Netzwerk “Bayern gemeinsam gegen Einsamkeit”. Ziel ist, Synergien zu schaffen, gute Praxis sichtbar zu machen und politische Unterstützung zu fördern. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches, aber auch politisches Thema, das Demokratie und Zusammenhalt betrifft.
Das Gespräch führte Oliver Marquart, Chef vom Dienst und Online-Redakteur beim Sonntagsblatt
Hinweis: Das Interview erschien am 28. Oktober 2025 bei Sonntagsblatt.de und ist unter diesem Link abrufbar. Wir danken dem Sonntagsblatt für die Erlaubnis, das Interview auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.
Bild: Dr. Hendrik Meyer-Magister während der Tagung “Die vielen Einsamkeiten” (Foto: dgr/eat archiv)