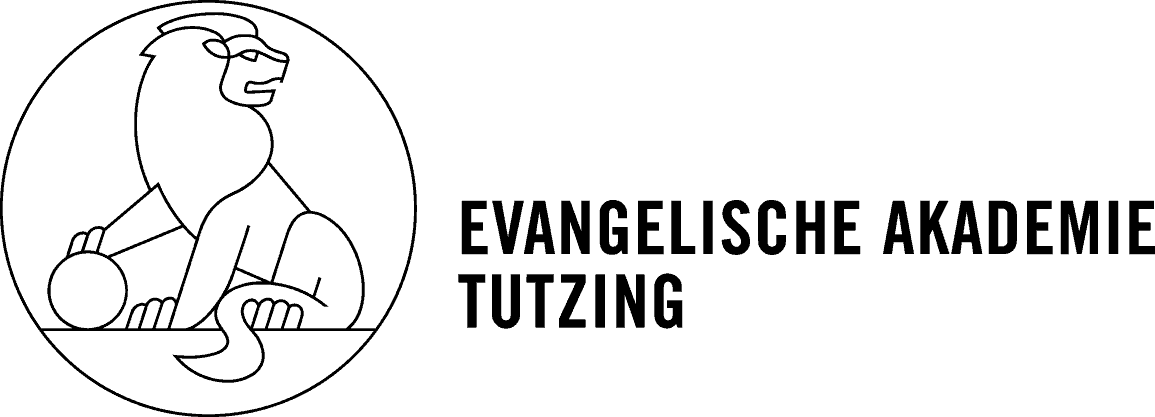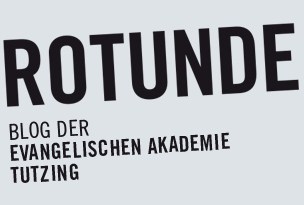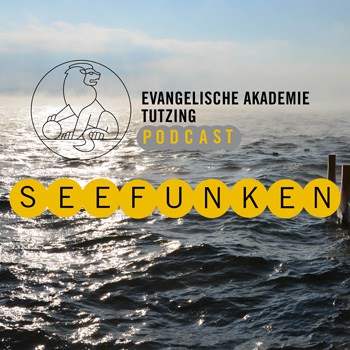Für eine konstruktive Einsamkeitspolitik
Einsamkeit ist mehr als ein persönliches Problem. Der Soziologe Berthold Vogel sieht in ihr sogar eine “soziale Provokation”, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft schwächt. Er sieht sowohl Politik als auch Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kultur in der Pflicht, dem entgegenzuwirken.
Von Berthold Vogel
Einsamkeit fordert uns heraus. Sie ist weit mehr als ein persönliches Problem. Einsamkeit ist eine soziale Frage, die den Wandel und die Veränderung von Gesellschaft sichtbar macht – nicht erst seit der Pandemie. Einsamkeit kann zu einem vollständigen Rückzug aus sozialen Beziehungen führen sowie physische und psychische Erkrankungen forcieren. Einsamkeit, gefasst als Verlusterfahrung und nicht etwa als selbst gewählte Weltflucht oder als Sehnsucht nach Ruhe im Getriebe der Welt, wirkt sich negativ auf das gesellschaftliche Miteinander aus. Denn Menschen, die ihre Lebenssituation als erzwungen einsam beschreiben, beteiligen sich vergleichsweise weniger am gesellschaftlichen und politischen Leben. Einsame Menschen – im Durchschnitt verschiedener Umfragen sprechen wir hier immerhin von 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung – fühlen sich oft nicht (mehr) als Teil der Gesellschaft. Sie beginnen, ihre Mitmenschen und ihre soziale Umwelt als negativ und feindlich wahrzunehmen. So verlieren sie das Interesse und die Energie, Gesellschaft mitzugestalten. Die Gesellschaft, das sind dann oft die Anderen, denen man mit Argwohn begegnet. Einsamkeit bedeutet Bindungsverlust, der es erschwert, den eigenen Ort in der sozialen Welt zu finden. So verwundert es auch nicht, dass es einsamen Menschen oft an politischem Vertrauen in demokratische Institutionen mangelt. Dies gilt mit Blick auf Parteien und Parlamente, aber auch gegenüber Verwaltungen oder Justiz. Einsame Menschen nehmen zudem weniger häufig an Wahlen teil und neigen eher zu Verschwörungserzählungen.
Kurzum, Einsamkeit kann sich zu einem anti-demokratischen Gefühl und zu einer a-sozialen Haltung entwickeln, die als signifikante Sozialerfahrung den Zusammenhalt einer Gesellschaft schwächt und den Potentialen der Solidarität, der Loyalität oder des Gemeinwohls den Boden entzieht. Ressentiments sind nicht die zwangsläufige Folge von Einsamkeitserfahrungen, aber Einsamkeit provoziert Ressentiments. Die Schwäche und die Krise demokratischer Strukturen und Institutionen ist nicht die Schuld der Einsamen, aber das grassierende Misstrauen in öffentliche Einrichtungen, in Amtsträger und Repräsentanten des Gemeinwesens, ist eben auch nicht ohne weit verbreitete Gefühle und Erfahrungen der Einsamkeit zu erklären.
“Die Pandemie hat unsere Begegnungsbedürftigkeit auf geradezu dramatische Weise sichtbar gemacht.”
Vor diesem Hintergrund plädiere ich daher dafür, Einsamkeit als eine soziale, politische und institutionelle Herausforderung zu verstehen, die an den sozialen, kulturellen und nicht zuletzt emotionalen Grundfesten demokratischer Gesellschaften rührt. Demokratien sterben langsam. Und Einsamkeit ist ein stiller Prozess, dessen Wirkung nicht abrupt und jäh einsetzt, der aber soziale Bindungen und Verpflichtungen langfristig und nachhaltig schwächt.
Was sind die gesellschaftlichen Ursachen negativer Einsamkeitserfahrungen? Es gibt hier nicht den einen Faktor, der Einsamkeit zum Problem werden lässt. Auch die Pandemie, die oftmals als Einsamkeitsbeschleuniger beschrieben wird, war nicht der Auslöser einer Einsamkeitswelle. Das Thema Einsamkeit bekam durch die Covid-Krise nur besondere Aufmerksamkeit, da Rückzug, Isolation und Kontaktverbot medizinisch geboten waren und politisch verordnet wurden. Mit Blick auf die vergangenen Jahre könnte man ja auch sagen, dass gerade die Pandemie unsere Begegnungsbedürftigkeit auf geradezu dramatische Weise sichtbar gemacht hat. Die Ursachen liegen daher tiefer. Sie sind zu finden in den Strukturveränderungen der Arbeitswelt, in der die individuelle Performance mehr zählt als das kollegiale Miteinander. Nicht umsonst tun sich Gewerkschaften in singularisierten, volatilen und digitalen Beschäftigungsformen schwer. Ein weiterer Punkt ist in diesem Zusammenhang der seit Jahrzehnten praktizierte und oftmals still vollzogene Rückzug öffentlicher Güter aus der Fläche. Die räumliche Ordnung unserer Gesellschaft hat sich verändert und damit das gesellschaftliche Klima vor Ort. Es sind nicht nur die jungen Leute, die Dorf und Kleinstadt verlassen, auch die öffentliche Hand reduziert(e) in vielen Landstrichen radikal ihre Präsenz und Erreichbarkeit. Wenn dann Orte sozialer Begegnung weniger werden, dann finden sich weniger Gelegenheiten „in Gesellschaft“ zu sein. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang überdies, wie lieblos und abweisend öffentliche Orte, Plätze und Einrichtungen oft gestaltet sind. Das gilt oftmals auch für Einrichtungen der Verwaltung, der Gesundheit oder der öffentlichen Bildung. Der Wille zur Gestaltung einladender, den Bewohnern zugewandter Quartiere hat in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch nachgelassen. Und ein weiterer, sehr wichtiger Faktor der negativen Einsamkeitsverstärkung kommt hinzu: der Strukturwandel der Familie, die fehlenden Bindungen und auch Verpflichtungen, die mit einem Leben in Generationenzusammenhängen einher geht, das Alleinleben, der drastische Zuwachs an Ein-Personen-Haushalten, übrigens nicht nur in den großen Städten. Das alles sind Prozesse, die deutlich an Fahrt aufgenommen haben.
Zugänge ermöglichen, aber nicht erzwingen
In welcher Weise könnte nun eine konstruktive Einsamkeitspolitik gestaltet werden, die auf Vereinzelung und Konkurrenz in der Arbeitswelt reagiert, die die veränderten familiären Beziehungen in Rechnung stellt und die auf die Vernachlässigung öffentlicher Räume reagiert? Auf der einen Seite ist festzuhalten, dass Staat und Politik Geselligkeit und Zusammenkunft nicht verordnen können. Einem jeden Bürger und einer jeden Bürgerin steht es frei, ob und wie sie sich in Gemeinschaft und Gesellschaft begeben wollen. Eine konstruktive Einsamkeitspolitik besteht daher nicht darin, die Menschen in Gemeinschaften zu zwingen. Es braucht in einer freien Gesellschaft unbedingt das Recht auf soziale Distanz. Auf der anderen Seite kann Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dennoch auf Veränderungen hinwirken. Denn einsam zu sein bzw. zu bleiben hat zwar oft mit persönlichen Erfahrungen zu tun, dennoch haben wir es hier nicht mit einem unabwendbaren Schicksal zu tun. Ebenso wenig ist Misstrauen in die Gesellschaft und ihre Institutionen eine zwangsläufige Folge der Polykrisen dieser Zeit.
Ein wesentlicher Faktor für mehr Verbundenheit und weniger Einsamkeit ist die Etablierung von Öffentlichkeiten, die einladend sind, Zugänge ermöglichen, aber eben nicht erzwingen. Es geht nicht um neue, exklusive Gemeinschaften, sondern um das Kernelement einer freien und pluralen Gesellschaft – es geht um Öffentlichkeiten, d.h. um die Etablierung und Gestaltung öffentlicher Orte, an denen sich Menschen gerne aufhalten, aber vor allem auch um die Stärkung öffentlicher Güter, die mit Blick auf Gesundheit und kultureller Geselligkeit, auf Mobilität und Verwaltung den Bedürfnissen der Menschen vor Ort gerecht werden. Es braucht neue Gelegenheitsstrukturen für Begegnung, dazu gehören sichere und attraktive öffentliche Plätze und Soziale Orte, die sowohl eher flüchtige Kommunikation wie auch demokratische Mitwirkung ermöglichen. Der schön gestaltete Stadtpark, die Bibliothek, die zugleich auch Café und Begegnungsort ist, die Mehrgenerationenhäuser, die betreutes Wohnen und Kindergarten zusammenbringen, sind gute Beispiele hierfür. Doch schon die Beispiele zeigen. Es geht nicht um staatliche Anordnung von oben, sondern um regionale, kommunale und lokale Aufgaben. Die Voraussetzung hierfür ist klar: Es braucht finanziell und personell starke Kommunen, denn sie sind der Dreh- und Angelpunkt einer konstruktiven Einsamkeitspolitik. Deshalb geht es bei der Frage, wie wir künftig mit Einsamkeit als sozialer Frage umgehen, immer auch um die Stärkung des Kommunalen und seiner Akteure. Wir – Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kultur – stehen mit Blick auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen vor Ort in der Pflicht, auf neue Weise in Begegnung und Zusammenhalt zu investieren. Einsamkeit als eine soziale Frage, ja als eine soziale Provokation anzuerkennen und sie eben nicht ausschließlich als persönliches Problem zu behandeln, bedeutet zuallererst, den Fragen von Gemeinwohl und Gleichwertigkeit, von Kooperation und Kommunikation mehr finanzielle wie infrastrukturelle Zuwendung und damit mehr gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit zu geben.
Über den Autor:
Prof. Dr. Berthold Vogel ist Professor für Soziologie an der Universität Göttingen, geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SoFi e.V.) sowie Sprecher des Standorts Göttingen im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ).
Hinweis:
Auf der Tagung “Die vielen Einsamkeiten” vom 31. Oktober bis 2. November 2025 in der Evangelischen Akademie Tutzing wird Berthold Vogel einen Vortrag zum Thema “Einsamkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt” halten sowie beim Abschlusspanel über gemeinsame Herausforderungen für Politik und Zivilgesellschaft neben Christian Druck, (Leiter des Referats „Strategie, Planung, Grundsatzfragen“ im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales) und Pfarrerin Gudrun Scheiner-Petry, (Leiterin der Wirkstatt evangelisch in Nürnberg) Podiumsgast sein. Alle Infos zum Programm und den Anmeldemodalitäten finden Sie hier.