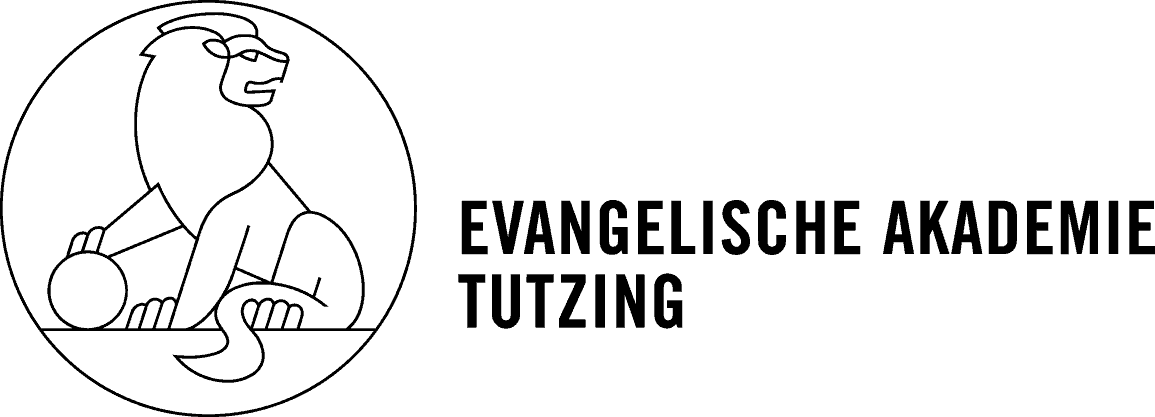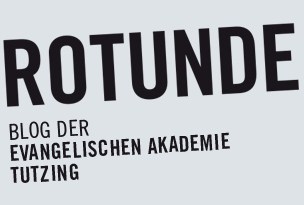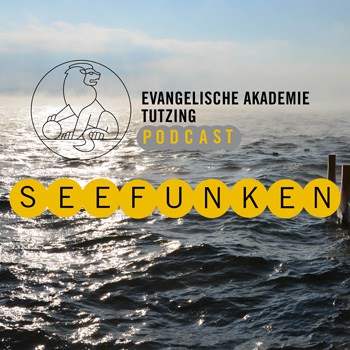Altbischof Johannes Friedrich gestorben
Die Ökumene und der christlich-jüdische Dialog haben Leben, Werk und Wirken des früheren bayerischen Landesbischofs Johannes Friedrich geprägt. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit 2011 führte er Udo Hahn als Akademiedirektor ein. Beide verband eine enge Zusammenarbeit. Eine persönliche Erinnerung zum Tod des Theologen am 3. September im Alter von 77 Jahren.
Seine letzten Lebensjahre waren von Krankheit und mancherlei Einschränkungen geprägt. Sein Lächeln ist bis zuletzt geblieben. Anlässlich des Todes von Altbischof Dr. Johannes Friedrich am 3. September ist in zahlreichen Nachrufen seine fröhliche Ausstrahlung gewürdigt worden. So ist er den Menschen begegnet – mit einer im Glauben wurzelnden Zuversicht.
Während des Zweiten Golfkriegs 1990/91, als der Irak Raketen auf Israel feuerte, hatte ich Kontakt mit Johannes Friedrich aufgenommen. Er war seit 1985 Propst der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache zu Jerusalem, wie diese Funktion offiziell heißt. Eine Auslandspfarrstelle, die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) getragen wird – mit einem Gemeindebezirk, der sich auf Israel, das Westjordanland und Jordanien erstreckt und mit der Erlöserkirche in Jerusalem eine historisch bedeutsame Predigtstätte hat. Als Redakteur der Wochenzeitung „Rheinischer Merkur“ in Bonn bat ich ihn, über seine Eindrücke und Erfahrungen zu berichten. Dass er in dieser kritischen Phase einer Gefährdung durch seine Rückkehr nach Deutschland hätte entgehen können, war für ihn kein Anlass, die Koffer zu packen. Sein Interesse am christlich-jüdischen Dialog und seine Art, Vertrauen aufzubauen, führten dazu, dass er in allen weiteren Positionen, die er bekleiden sollte, eine Expertise einbrachte, die ihn zum geschätzten Gesprächspartner und Ratgeber machte – bis weit in seinen Ruhestand hinein.
1991 kehrte Friedrich nach Bayern zurück und wurde Dekan in Nürnberg. 1996 wurde er in die Landessynode gewählt und ergriff dort die Initiative für die Vereinbarung „Zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Christen und Juden“. Die Bedeutung des Dialogs, der inhaltlichen Differenzierung, war ihm als Propst in Jerusalem deutlich geworden. Er habe Schwierigkeiten mit Leuten, die beim Nahost-Konflikt „ganz genau zu wissen scheinen, wer Recht hat und wer im Unrecht ist“, sagte er.
Friedrich war von 1999 bis 2011 bayerischer Landesbischof. Besonders am Herzen lag ihm das christlich-jüdische Gespräch und der Dialog mit den Musliminnen und Muslimen. Mit seinem entschiedenen Einsatz gegen alle Formen von Extremismus und Antisemitismus zählte er 2005 zu den Gründern des Bayerischen „Bündnisses für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“, dessen Sprecher er auch war. Ein weiterer Meilenstein in seiner Amtszeit: die Einweihung der Ohel-Jakob-Synagoge in München am 9. November 2006. Friedrich hat an diesem Tag die Bedeutung des jüdisch-christlichen Dialog unterstrichen.
Als weiterer Schwerpunkt seines Wirkens zeichnete sich früh die Ökumene ab. 2000 bis 2005 war Friedrich Catholica-Beauftragter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), bevor er 2005 zum Leitenden Bischof der VELKD gewählt wurde. Dieses Amt übte er bis 2011 aus, und zwar in Personalunion mit dem Amt des Vorsitzenden des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB). Von 2002 bis 2013 gehörte Friedrich auch dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an.
Der Ökumenische Kirchentag 2010 in München sowie im selben Jahr die 11. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Stuttgart wären ohne sein Engagement so nicht möglich gewesen und zählen zu den Höhepunkten seines Lebens. Sein Nachnachfolger Landesbischof Christian Kopp würdigte Friedrich als „ökumenischen Brückenbauer“, der für eine Kirche mitten in der Welt eingetreten sei.
Auch die Bildungsarbeit der Kirche war Friedrich stets ein Anliegen. In seiner Zeit als Landesbischof war er zusammen mit seiner Frau Dorothea häufig Gast in der Evangelischen Akademie Tutzing. Bei der Verabschiedung von Akademiedirektor Friedemann Greiner am 18. Mai 2011, der zwei Jahrzehnte die Geschicke der Denkwerkstatt lenkte, würdigte er die Einrichtung als etwas „Einzigartiges“, wozu für ihn u.a. die Jahresempfänge und die Tagungen des Politischen Clubs gehörten. Mit der Gründung dieser Akademie im Jahre 1947 habe man Lehren aus der Zeit der Diktatur des Nationalsozialismus gezogen und „wollte dabei auf keinen Fall wieder im innerkirchlichen Kreis steckenbleiben“. Tutzing sei zum Vorbild geworden: „als Ort des theologisch weltoffenen Dialogs, als Kommunikationsforum zwischen Kirche und Welt, das zudem kirchenferne und kirchenfremde Gruppen anzusprechen vermag und auch in die politische Kultur hineinwirkt.“
Zu Fragen des christlich-jüdischen Dialogs, der Ökumene sowie der Ausrichtung einer Bildungsarbeit an der Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft waren Gespräche mit Johannes Friedrich stets produktiv und eröffneten weiterführende Perspektiven. Zuhören, verstehen, vermitteln und eine eigene Position einbringen – das zeichnete ihn aus. Und das war auch der Grund, weshalb die Akademie Johannes Friedrich zum Abschied aus dem Bischofsamt mit dem „Tutzinger Löwen“ ehrte – und ihm ein bleibendes Andenken bewahren wird.
Der Autor, Udo Hahn, leitet seit 2011 die Evangelische Akademie Tutzing. Zwischen 1999 und 2011 war er u.a. Pressesprecher und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sowie Pressesprecher des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB).
Der Beitrag verwendet Material des Evangelischen Pressedienstes (epd).
(Fotos: Oryk Haist, eat archiv)