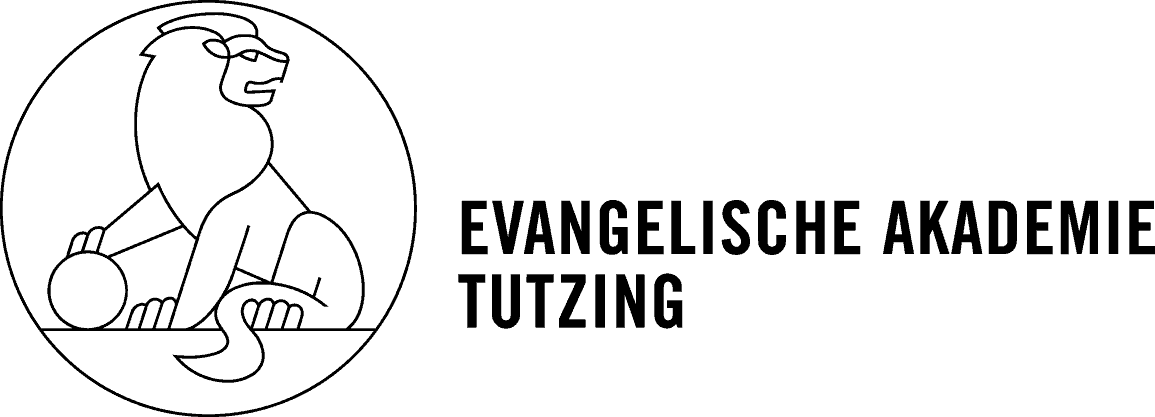„NS-Vergangenheit – wie nah, wie fern?“ – eine Tagung zeigt Errungenschaften und Fallstricke der Erinnerungskultur
„Sophie Scholl würde AfD wählen“ – manches Mal ist man fassungslos über die Äußerungen und Botschaften des Rechtspopulismus, die Richard Gebhardt bei der Tagung „NS-Vergangenheit – wie nah, wie fern?“ am Sonntag referiert. Mit dieser dreisten Behauptung hat nämlich die AfD Nürnberg Süd in ihrem letzten Wahlkampf geworben, und das ist natürlich nicht die einzige propagandistische Ausnutzung des sensiblen Vergangenheitsfeldes, die sich die Rechte erlaubt. Im Gegenteil: Vom Neo-Nazismus der Extremen über den Anschluss an die „Konservative Revolution“ der Zwanzigerjahre bei der Neuen Rechten bis zum „Stolz“ der Rechtspopulisten auf das, was die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg „geleistet“ hat, reicht das Spektrum, das der Politikwissenschaftler Gebhardt anhand von Beispielen aus Reden, Artikeln und Blogs präsentiert. Dass die Rechte sich an dieser Thematik abarbeitet, so der Historiker Janosch Steuwer schon am Vortag, zeigt immerhin einen gewissen Erfolg der Erinnerungskultur, die eben doch zu einem öffentlichen Konsens über die Verantwortung des gegenwärtigen Deutschland für eine Aufarbeitung der Vergangenheit gelangt sei. In der abschließenden Diskussion mit Nina Ritz vom Max-Mannheimer-Studienzentrum in Dachau, und der Extremismusforscherin Britta Schellenberg ging es dann vor allem um die Frage, wie man gegen solche Demagogie arbeiten kann. Sie berichteten über die Entwicklung von Schulungsmaterialien und die Arbeit damit, über behutsame Kommunikation gerade mit Jugendlichen und über die Vermeidung von Empörungsrhetorik und Moralschelte, auch bei rassistischen oder geschichtsrevisionistischen Äußerungen, die besser durch Fakten, nüchterne Argumentation und schlüssige Erklärungen auszuhebeln seien. Aufklärung, Veranschaulichung – so wurde ein Interview-Clip mit dem Sohn eines NSU-Mordopfers gedreht – und Anknüpfen an die pluralen Lebenswirklichkeiten in der Migrationsgesellschaft – darüber hatte am Vortag Astrid Messerschmidt anhand von Beispielen aus der universitären Lehre berichtet – scheinen hier den Weg zu weisen.
Das lag auch auf der Linie des Historikers und Gedenkstättenexperten Habbo Knoch, der u.a. über die digitale Rekonstruktion der Lager-Topographie in Bergen-Belsen berichtete. Besuchende der Gedenkstätte können so einen virtuellen Rundgang durch das Konzentrationslager machen und haben damit noch einen anderen Zugang als im analogen Zeitalter. Dass technische Möglichkeiten und die Erfordernisse einer modernen aufklärerischen Geschichtsarbeit sensibel miteinander in Einklang zu bringen sind, darauf hatte schon am Vortag der Medienhistoriker Wulf Kansteiner hingewiesen, der digitale und interaktive Zugänge aber selbst für den Umgang mit der Geschichte des Holocaust als in Zukunft möglich ansieht.
In der Tagung wurde immer wieder deutlich, dass der Umgang mit dem Nationalsozialismus ganz stark ein Spiegel gesellschaftlicher Problemlagen und Diskurse ist. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, Mary Fulbrook und Gudrun Brockhaus führten das aus, konnten die Überlebenden die Schweigemauern in der Tätergesellschaft kaum überwinden. Wie diese Mauern in der Gesellschaft wirkten und wirken, wurde bei Marina Mayers Lesung literarischer und eigener Texte plastisch. Dass bis zur gegenwärtigen Kriegsenkel- und Urenkelgeneration ein persönlich ehrlicher Umgang mit den Verbrechen oft nicht stattfindet, man lieber von „den Nazis“ als etwa belasteten Familienmitgliedern spricht, problematisierten mehrere Referierende. Möglichkeiten der Psychotherapie, in einem „archäologischen“ Verfahren bis zu den Tiefenschichten der Erinnerung, bis zur eigenen oder familiären NS-Sozialisation durchzudringen, erläuterte die Psychologin Ulrike Pohl. In den dreißiger Jahren ein Nationalsozialist zu werden, war zwar eine vom Regime strafbewehrte Selbstverständlichkeit, aber, wie Janosch Steuwer aus Tagebüchern zeigte, auch gewissermaßen biografische Konstruktion – genauso wie umgekehrt nach dem Krieg der „Nicht-Nazi“ wieder konstruiert werden musste. Familienbiografische Spurensuche heute kann daher echt zur Detektivarbeit werden, machte Thomas Medicus anhand seines Buches über den Großvater deutlich. Vielleicht für die bundesdeutsche Gesellschaft noch beschämender als individuelle Leugnung und Umdeutung ist die Tatsache, dass die justizielle Aufarbeitung und rechtsstaatliche Sühne für so viele Verbrechen versäumt wurde – thematisiert und differenziert (im Vergleich mit der DDR) wurde das im Referat von Annette Weinke. Für die Justiz ist es zu spät, aber eine Geschichtskultur zu entwickeln, an die auch Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention anknüpfen können, daran lässt sich immer noch arbeiten. Und das macht es als Tagungsthema so spannend.
Ulrike Haerendel
Bildunterschrift: Christoph Boekel (rechts) wird von seinem Kollegen Matti Bauer über seinen Film „Die Spur des Vaters“, der bei der Tagung gezeigt wurde, interviewt.